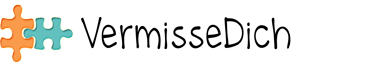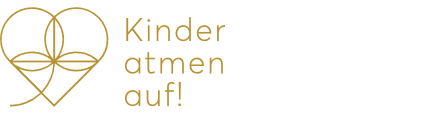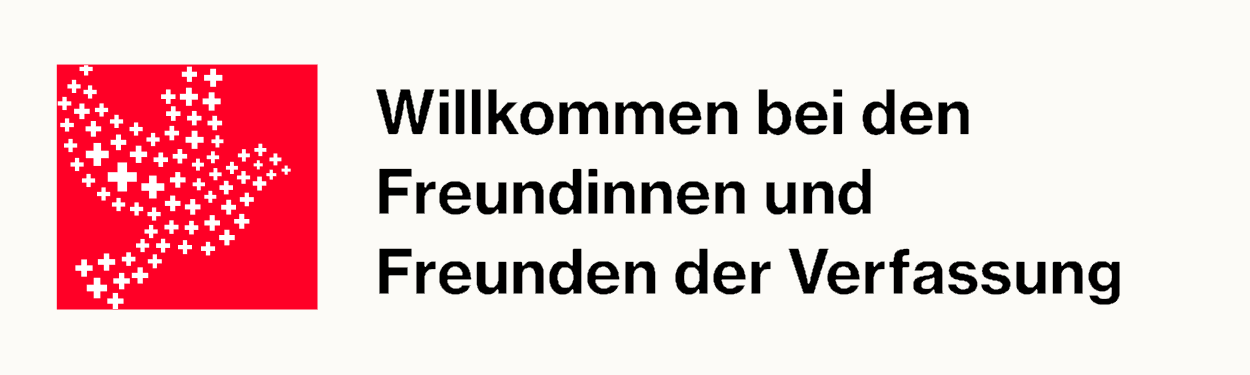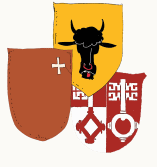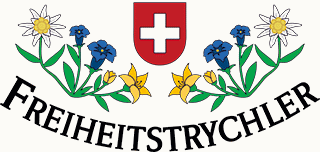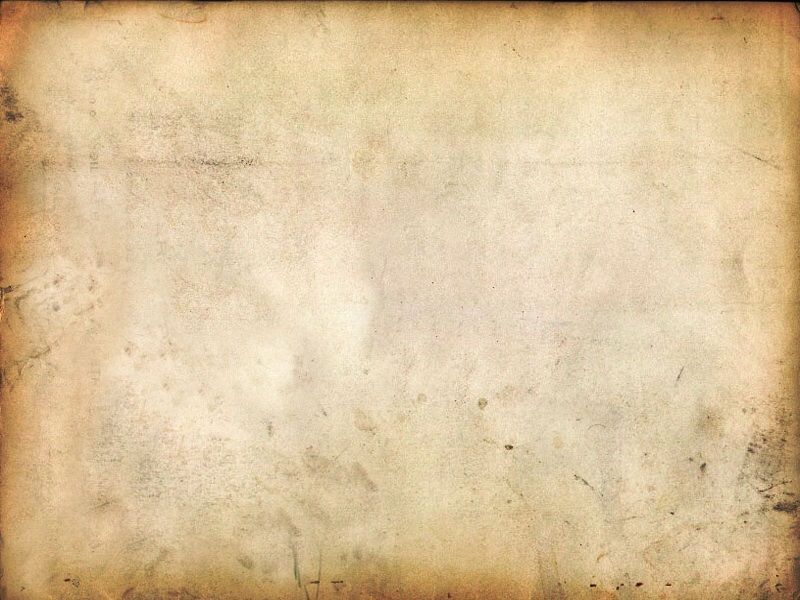Über hundert Bände mit Kesb-Entscheiden sind durch die Hände von Insassen und Gefängnisangestellten gegangen. Betroffene dieses Geheimnisverrats verlangen eine Strafuntersuchung.
Da haben sich so manche ungläubig die Augen gerieben: Ausgerechnet Akten mit einem überaus heiklen, höchstpersönlichen Inhalt sind jahrelang und in rauen Mengen in die Buchbinderei der Strafanstalt Pöschwies geliefert worden – damit sie dort von Insassen bearbeitet werden konnten. Bei den Dokumenten handelte es sich um Fälle beziehungsweise Entscheide der Stadtzürcher Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb).
Es geht um Hunderte, wenn nicht um Tausende von Seiten, auf denen unter anderem Namen, Alter und Adressen von Erwachsenen und Kindern stehen, die in irgendeinem Zusammenhang mit der Kesb oder zuvor mit der Vormundschaftsbehörde zu tun hatten. In solchen Dokumenten werden in aller Regel schwierige Lebensphasen und Lebensumstände thematisiert; also lauter Vorgänge, die keiner in aller Öffentlichkeit herumgeplappert oder herumgereicht haben möchte.
Jahrelang andauernde Panne
Wer von einer Kesb-Massnahme betroffen ist, geht im Gegenteil davon aus, dass die Unterlagen streng vertraulich behandelt werden. Im Oktober vergangenen Jahres wurde bekannt, dass dies nicht immer der Fall war: Ein Pöschwies-Insasse informierte einen Aargauer Fernsehsender über den heiklen Buchbindeauftrag, die Behörden bestätigten den Vorfall sofort und sprachen von einer Panne – die allerdings jahrelang andauerte.
Ein gutes Dutzend Betroffene wehrt sich nun dagegen, dass ihre Fälle im Gefängnis gelandet sind. Die Männer, Frauen und Kinder geben sich nicht damit zufrieden, dass alle Beteiligten, sei es vonseiten der Kesb oder der Strafanstalt, Fehler eingestanden und Besserung gelobt haben. Sie verlangen zusätzlich eine strafrechtliche Untersuchung wegen Amtsgeheimnisverletzung. Ihnen steht ein hürdenreicher Weg bevor: Die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich beantragt dem Obergericht, es sei keine Ermächtigung zur Durchführung einer Strafuntersuchung zu erteilen.
Dieser erste Schritt – die gerichtliche Erteilung einer Ermächtigung – ist notwendig, weil es sich bei den potenziellen Beschuldigten um Behördenmitglieder handelt, die sich im Zusammenhang mit ihrer amtlichen Tätigkeit allenfalls strafbar gemacht haben. Die Anzeige richtet sich gegen zwei Mitarbeiter der Kesb und drei Angestellte der Strafanstalt sowie gegen Sozialvorsteher Raphael Golta. Der Präsident der Stadtzürcher Kesb hingegen wurde bisher nicht belangt, ebenso wenig der Gefängnisdirektor.
Sieben Beschlüsse sind verschwunden
In ihrer zehnseitigen Überweisungsverfügung an die III. Strafkammer des Obergerichts kommt Staatsanwältin Christine Braunschweig zum Ergebnis, die Ermächtigung zur Durchführung einer Strafuntersuchung gegen die sechs Angezeigten sei nicht zu erteilen: Nach einer «summarischen Prüfung» liege «kein deliktsrelevanter Verdacht vor».
Für die Staatsanwältin ist insbesondere ausgeschlossen, dass die involvierten Angestellten die Geheimnisverletzung in Kauf genommen oder gar gewollt hätten. Braunschweig geht also davon aus, dass es am erforderlichen Vorsatz oder Eventualvorsatz fehlt. Hingegen erwähnt sie mangelnde Sensibilität und Weitsicht: Man sei offenbar zu leichtfertig davon ausgegangen, dass dank angeblichen Sicherungsmassnahmen die Wahrung der Geheimhaltung gewährleistet sei.
Trotz dieser Aufsicht sind Akten in eine Zelle gelangt und Geheimdokumente im Umfang von zwölf A-4-Seiten spurlos verschwunden.
Mit diesen «Sicherungsmassnahmen» spricht die Staatsanwältin den Umstand an, dass die Insassen, die mit dem Binden der Kesb-Akten beauftragt wurden, stets allein und an einem gesonderten Arbeitsplatz tätig waren sowie beaufsichtigt wurden. Die Aufsichtsperson musste allerdings zehn weitere Insassen im Blickfeld haben. Und trotz dieser Aufsicht sind Akten in eine Zelle gelangt und Geheimdokumente im Umfang von zwölf A-4-Seiten spurlos verschwunden; es handelt sich dabei um sieben Beschlüsse der Kesb.
Vier Jahrgänge betroffen
Aus der Verfügung der Staatsanwaltschaft geht weiter hervor, dass Gespräche mit den involvierten Gefangenen geführt sowie sämtliche Abfallcontainer, Säcke und Aktenvernichter durchsucht wurden. Es kam zu Zellenkontrollen und einer verstärkten Briefzensur, doch die Unterlagen bleiben bis heute verschwunden. Kein Wunder, gehen die Betroffenen davon aus, dass die mit der Arbeit betrauten Insassen und Angestellten sehr wohl realisierten, was sie da in den Händen hielten.
Wie viele solcher Dokumente in die Pöschwies gelangten, ist unklar. Die Staatsanwältin zitiert in ihrer Verfügung einerseits einen Bericht der Kesb, in dem von 144 Spruchbüchern die Rede ist: Insgesamt 48 Spruchbücher aus den Jahren 2008 und 2009 sowie zusätzliche 96 Bücher aus den Jahren 2013 und 2014. Bei den früheren zwei Jahrgängen war noch die Vormundschaftsbehörde zuständig, bei den neueren die Kesb. Das Amt für Justizvollzug wiederum spricht von 48 Archivbänden aus den Jahren 2008 und 2009 sowie von weiteren 48 Bänden aus den Jahren 2013 und 2014.
Unabhängig von der Quantität der geheimen Dokumente zweifelt Staatsanwältin Braunschweig offensichtlich daran, dass die Insassen vom Inhalt Kenntnis genommen hätten. Diese Auffassung erstaunt, steht doch fest, dass es sich bei den beauftragten Strafgefangenen (die langjährige Strafen wegen schlimmster Gewaltdelikte verbüssen) weder um Analphabeten noch um Blinde handelt. Ebenso klar ist, dass die Vorsichtsmassnahme mit dem separierten Arbeitsplatz und der besonderen Aufsicht nicht funktioniert hat, sind doch Aktenstücke eingestandenermassen bis heute verschwunden und sind sie mindestens einmal in eine Zelle genommen worden.
Zur Verfügung stellen genügt
Was die Kenntnisnahme der geheimen Kesb-Akten betrifft, gibt es immerhin massgebende Lehrmeinungen und Gerichtsentscheide, die davon ausgehen, das Delikt der Amtsgeheimnisverletzung sei bereits dann erfüllt, wenn nur schon die Möglichkeit einer Kenntnisnahme geboten werde. Das heisst mit anderen Worten: wenn der geheime Inhalt Unbefugten zugänglich gemacht wird, unabhängig davon, ob sie ihn lesen oder nicht. Im Fall der Akten in der Pöschwies ist davon auszugehen, dass die Dokumente gelesen wurden. Einerseits, weil gewisse Akten verschwunden sind, und andererseits auch deshalb, weil es ein Insasse war, der den Vorfall publik gemacht hat.
Im Fall der Akten in der Pöschwies ist davon auszugehen, dass die Dokumente gelesen wurden.
Ob die Angelegenheit tatsächlich nicht vors Strafgericht gehört, ist trotz der ablehnenden Haltung von Staatsanwältin Christine Braunschweig noch nicht entschieden. Das Obergericht hat die Anzeigeerstatter eingeladen, zum Schreiben der Staatsanwaltschaft Stellung zu nehmen. Die III. Strafkammer erinnert daran, dass sie als Ermächtigungsbehörde nicht über den Tatverdacht im Detail zu befinden habe – und nur «bei offensichtlich und klarerweise unbegründeten Strafanzeigen» die Ermächtigung der Untersuchung verweigere.
Einhellige Ansichten
Die Staatsanwältin geht im Übrigen davon aus, dass nur jene Betroffenen eine Geschädigtenstellung beanspruchen dürften, deren Akten verschwunden sind. Auch diese Einschätzung wird von den Anzeigeerstattern wohl kaum widerspruchslos hingenommen, wurden doch ihre Geheimnisse auch ohne Diebstahl Unberufenen zugänglich gemacht.
Der Weg vor den Strafrichter ist der vierte Versuch, das Vorgefallene aufzuarbeiten und einzuordnen. Bereits zuvor haben sich die Geschäftsprüfungskommission des Kantonsrats, die Kesb selbst (zuhanden des Gemeindeamts) sowie das Amt für Justizvollzug (zuhanden der Justizdirektion) geäussert. Die Meinung fällt ungewöhnlich einhellig aus: Die Kesb-Akten hätten nicht in die Strafanstalt gehört, hätten nie den Insassen zum Binden übergeben werden dürfen. Das Problem dürfte sich künftig nicht mehr stellen, da die Entscheide ab 2015 nur noch elektronisch archiviert werden.
(Von Brigitte Hürlimann)