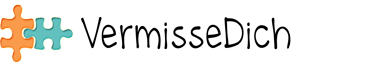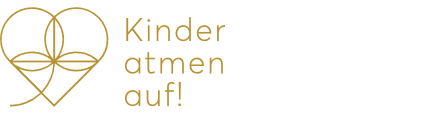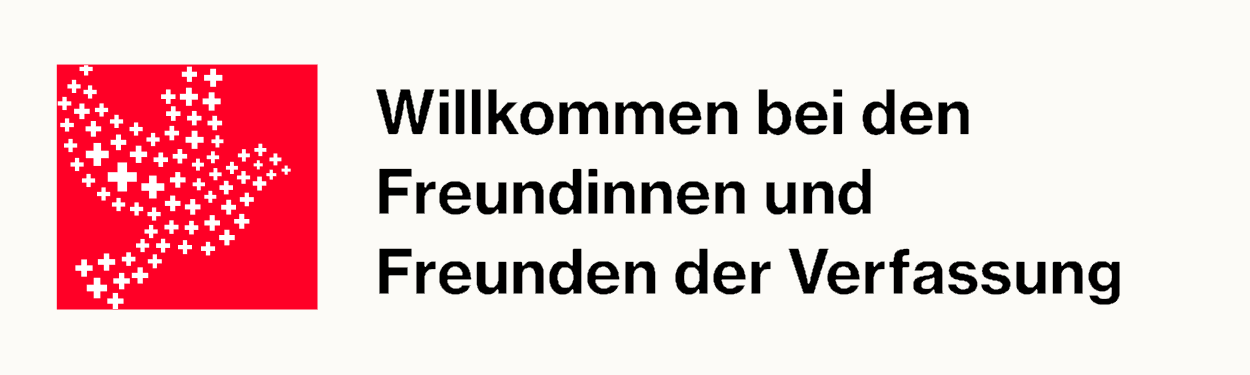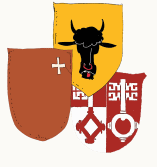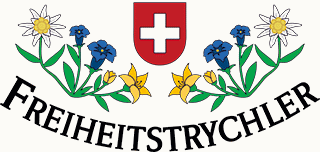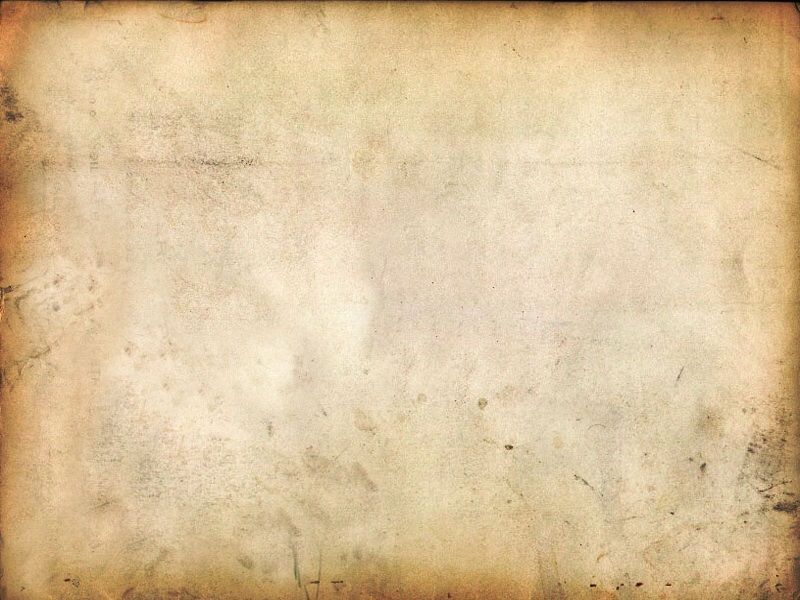Die Kritik am neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht hält an. In den Kantonen Thurgau und St. Gallen sind zwei Vorstösse geplant. Eine Expertin hält von beiden wenig.
Seit 2013 ist im Vormundschaftswesen nichts mehr so wie vorher. Das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht löste das über 100jährige Vormundschaftsrecht ab. An der Umsetzung ist landesweit immer wieder Kritik laut geworden – auch nach 21 Monaten ist sie nicht verstummt. «Der Aufwand hat gewaltig zugenommen», sagt Max Brunner. Der Thurgauer ist Leiter der Berufsbeistandschaft der Region Weinfelden. Er legt aber Wert darauf, dass er sich nicht als Behördenvertreter zum neuen Gesetz äussert, sondern als Politiker. Seit 1992 ist er SVP-Kantonsrat, zudem Vizepräsident der parlamentarischen Justizkommission. Brunner bereitet die zu dünne Personaldecke bei den Thurgauer Behörden Sorgen. Die fünf kantonalen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) sind mit 39,6 Vollzeitstellen gestartet. «Das ist eindeutig zu wenig.» Wie es im Jahresbericht des Obergerichts über die KESB heisst, war die Belastung teils so gross, dass es zu gesundheitlichen Ausfällen oder Kündigungen kam. «Ich glaube nicht, dass sich in drei Jahren alle KESB-Mitglieder zur Wiederwahl stellen», meint Brunner.
Richtlinien fehlen
Unter einer schweren Arbeitslast leiden auch die Berufsbeistandschaften. Bereits im Frühjahr 2014 ist Brunner im Parlament vorstellig geworden. Mit einer Interpellation forderte er eine Auslegeordnung. Er verweist auf eine Umfrage unter den 13 Berufsbeistandschaften. Elf haben mitgemacht, fünf fühlen sich «sehr knapp» und drei «sehr knapp/zu tief» mit Personal ausgestattet. Erschwerend kommt hinzu, «dass die Berufsbeistandschaften zwischen Amboss und Hammer geraten», wie Brunner sagt. Die Aufträge erhalten sie von den KESB – brauchen sie aber mehr Personal, müssen sie sich an die Gemeinden wenden. Für den Kantonsrat wären deshalb Richtlinien sinnvoll, «da sonst zu viel vom Goodwill der Gemeinden abhängt», sagt Brunner. Bei den Richtlinien geht es darum, Mandatszahlen pro Berufsbeistand festzulegen. 40 bis 50 Fälle hält er für angemessen. Alles über 50 sei zu viel. In Weinfelden lag die Zahl zwischenzeitlich bei 70 und mehr, dank einer Personalaufstockung pendelt sie sich um die 60 ein. «Wenn wir zu viele Fälle haben, dann können wir aus Zeitmangel die Klienten nicht mehr richtig betreuen. Das steht im Widerspruch zum Gesetz», sagt er.
Brunner glaubt nicht, dass alle derzeitigen Probleme auf Anfangsschwierigkeiten zurückzuführen sind. Die Belastung hänge mit der Höhe der Fallzahlen und Gefährdungsmeldungen zusammen. «Diese haben massiv zugenommen. Die Hemmschwelle ist gesunken, da die KESB anonymer sind», sagt er. Ende Jahr lag die Anzahl Massnahmen im Thurgau bei 3890, ein direkter Vergleich zum Vorjahr ist aufgrund des Systemwechsels nur schwer möglich. Brunner rechnet damit, dass die Belastung hoch bleiben wird. Derzeit überlegt er sich einen weiteren parlamentarischen Vorstoss. «Man müsste die Aufträge enger fassen und die Massnahmen reduzieren, um den Aufwand in einen vernünftigen Rahmen zu bringen», sagt er und warnt: «Ansonsten dürfte es bei KESB-Mitgliedern und Berufsbeiständen weiter zu Burn-outs, Krankheiten und Kündigungen des Arbeitsverhältnisses kommen.»
Problem Zügelnomaden
Der Thurgau ist kein Einzelfall. Im Appenzellerland und im Kanton St. Gallen zeigt sich ein ähnliches Bild. Die Anzahl Gefährdungsmeldungen hat in Ausserrhoden stark zugenommen. War man im Gesetzgebungsprozess von 200 neuen Mandaten ausgegangen, hatte die KESB Ende 2013 mehr als doppelt so viele Fälle zu bearbeiten. «Damit haben wir nicht gerechnet. Die akute Belastung innerhalb der KESB war und ist dadurch zeitweise sehr hoch. Wir müssen uns vor allem auf dringende Kindesschutzmassnahmen konzentrieren», sagt Jolanda Oelke, Präsidentin der Ausserrhoder KESB.
Neben dem Anstieg der Gefährdungsmeldungen bekam es Ausserrhoden auch mit aufwendigen Fällen von «Zügelnomaden» zu tun. Diese ziehen aus den ursprünglichen Wohnkantonen weg, weil die dortigen Behörden Kindesschutzmassnahmen angeordnet oder angedroht haben. Bezüglich Personaletat ist Besserung in Sicht: Dieser wird auf das kommende Jahr hin um 120 Stellenprozente erhöht. «Der Regierungsrat hat der Aufstockung trotz Sparpaket zugestimmt», sagt Oelke.
Im Kanton St. Gallen ist die Arbeitsbelastung ebenfalls hoch. Wie es in einer Antwort der Regierung Anfang Jahr zu einem parlamentarischen Vorstoss heisst, mussten mit Ausnahme einer KESB-Behörde jeweils personelle Aufstockungen vorgenommen werden. In St. Gallen wird nun auch die Rolle der Gemeinden thematisiert. Deren marginale Beteiligung gibt schweizweit immer wieder Anlass für Kritik. Der Ärger ist gross, weil die KESB Massnahmen bestimmen, die jedoch von Gemeinden bezahlt werden müssen. «Die Mitwirkung der Gemeinden kann und muss verbessert werden», findet auch Beat Tinner, Gemeindepräsident von Wartau und Präsident der Vereinigung der St. Galler Gemeindepräsidenten. Seine Partei, die FDP, wird in der anstehenden Septembersession des Kantonsrats einen Vorstoss einreichen. Die Freisinnigen verlangen, dass die Gemeinden besser informiert und angehört werden, Akteneinsicht erhalten und mitbestimmen können.
«Erwartungen sind zu hoch»
Für Diana Wider, Generalsekretärin der Kokes (Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz), kommt die Kritik an der Umsetzung des neuen Gesetzes nicht überraschend. «Der Wechsel war so gross, dass ein Rumpeln zu erwarten war.» Es brauche fünf bis zehn Jahre, bis sich das neue System etabliert habe, sagt die Dozentin der Hochschule Luzern. Als eine der Schwierigkeiten nennt die gebürtige Eichbergerin die «riesige Erwartungshaltung». Häufig gehe vergessen, dass mit dem neuen Gesetz eine «komplett neue Grundhaltung» Einzug gehalten habe. Das alte Gesetz orientierte sich an «08/15-Menschen»; das neue trägt dem gesellschaftlichen Wandel, also der Individualität und Selbstbestimmung Rechnung. «Das allein ist schon anspruchsvoll, hinzu kommt aber, dass wir eine grundlegend neue Organisation aufbauen mussten. Diesen Aspekt haben wir unterschätzt. Er braucht mehr Zeit als angenommen», sagt sie.
Von den Vorschlägen der FDP und Max Brunners hält sie wenig. Der Vorstoss der Freisinnigen gehe zu weit. Das Bundesgericht habe klar festgehalten, dass die KESB bestimmen, ob und welche Massnahmen es braucht. «Dies entspricht auch den Empfehlungen der Kokes.» Eine Reduktion der Massnahmen hält sie für nicht möglich. Denn das Gesetz schreibe vor, dass der Klient nur solche erhalte, die tatsächlich notwendig sind. «Ziel des neuen Gesetzes ist ja, dass die Betroffenen so selbständig wie möglich bleiben».
Zurückhaltend ist sie auch bezüglich Gefährdungsmeldungen und Mandatszahlen. Zwar melden Kantone Zunahmen, gesamtschweizerische Zahlen würden aber noch keine vorliegen. «Ich bin vorsichtig mit voreiligen Schlüssen. In vielen Gemeinden haben die Vormundschaftsbehörden bereits Ende 2012 mit dem Wissen um die neue KESB aufgehört, Meldungen aufzunehmen. Dies könnte eine Erklärung für den vorübergehend überdurchschnittlichen Anstieg sein.»



 (6 Bewertungen, Durchschnittlich: 3,33 von 5)
(6 Bewertungen, Durchschnittlich: 3,33 von 5)