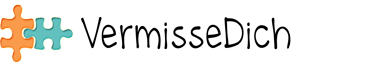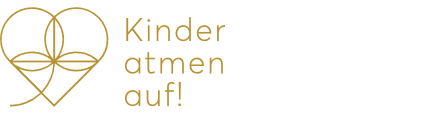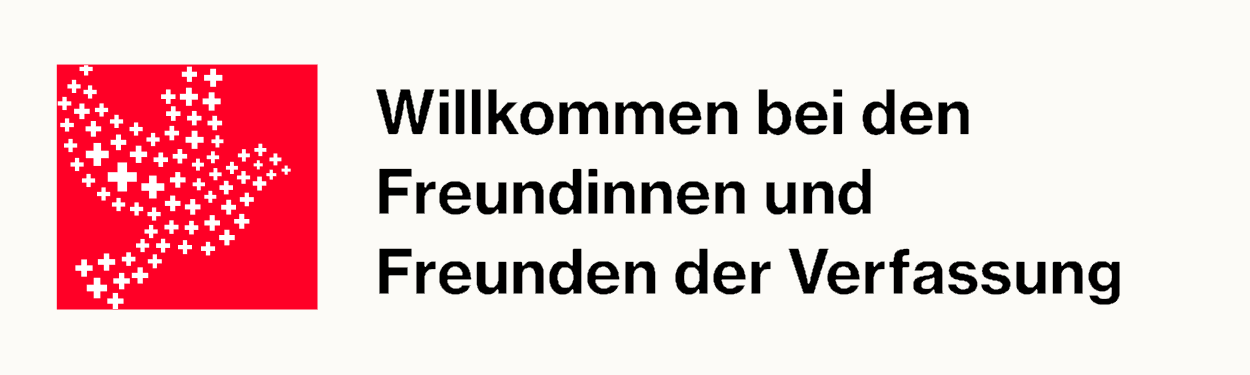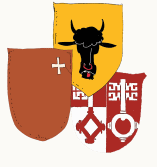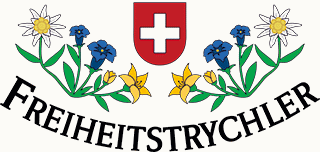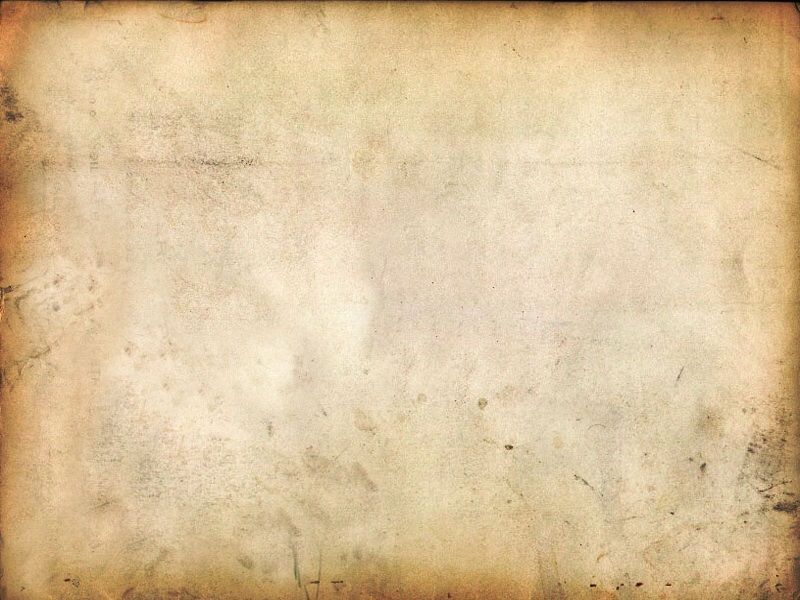Das Bundesgericht hat ein Urteil gefällt, das den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden die Arbeit erleichtern wird.
Es sind gute Zeiten für Kinder. Das Bundesgericht hat kürzlich in einem Fall aus dem Kanton Solothurn entschieden, dass eine urteilsfähige Jugendliche selber entscheiden kann, ob sie beim Vater oder bei der Schwester wohnen will. Und nun liegt ein weiteres Urteil des höchsten Schweizer Gerichts vor, in dem der Stellenwert des Kindeswohls betont wird. Diesmal geht es um eine Familie aus Dübendorf, bei der die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) 2014 Hortbesuche und eine Beistandschaft für die beiden Kinder angeordnet hat. Die Eltern waren einverstanden, wiesen aber darauf hin, dass ihnen das Geld dafür fehle. Die städtische Sozialbehörde weigerte sich ebenfalls, zu zahlen, weil sie der Ansicht war, dass die Eltern die Massnahme finanzieren könnten. Die Folge war, dass der Beistand zunächst gratis arbeitete und die Massnahme schliesslich abgebrochen werden musste.
Das sei kein Einzelfall, sagt Ruedi Winet, Leiter der Kesb Pfäffikon. Es hänge stark von der jeweiligen Gemeinde ab, wie gut die Zusammenarbeit mit den Kesb funktioniert. Bei einigen Zürcher Gemeinden käme es immer wieder zu Streit. Doch damit ist nun Schluss, so die Hoffnung von Winet und weiteren im Kindesschutz tätigen Personen. Denn das Bundesgericht hat im Fall aus Dübendorf entschieden, dass die Stadt hätte zahlen müssen, und zwar sofort und vollumfänglich. Erst später hätte sie das Geld bei den Eltern oder allfälligen Dritten eintreiben können. Die sozialrechtliche Abteilung des Bundesgerichts wies den Fall in seinem am 19. Juni gefällten Urteil zurück an die Sozialbehörde in Dübendorf.
Bereits zweimal am Bundesgericht
Vorausgegangen war ein langer Rechtsstreit zwischen der Stadt Dübendorf und den Kindern, die von der Rechtsanwältin Noëlle Cerletti vertreten wurden. Diese hatte auch die Kesb beauftragt. Im April 2014 hatte die Behörde die Massnahme verfügt. Das Bundesgericht wurde in der Angelegenheit zweimal bemüht. Zuerst ging es um die Frage, ob die Kinder zur Beschwerde berechtigt seien, was der Bezirksrat Uster und das Zürcher Verwaltungsgericht verneinten, das Bundesgericht im Sommer 2016 jedoch bejahte.
Das endgültige Urteil im Fall Dübendorf wird die Rechtsprechung im Bereich Kindesschutz prägen, so die Hoffnung von in der Branche tätigen Personen. Jurist und Sozialarbeiter Christoph Häfeli ist «glücklich», er hofft, dass das Urteil zu einer Trendwende führt. Der Aargauer hatte schon bei der Entstehung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts mitgewirkt, heute berät er die Kesb und Beistände in sechs Kantonen.
Dieses Urteil stellt klar, dass das Wohl des Kindes Vorrang hat vor anderen Interessen.
Bis heute herrsche bei der finanziellen Entgeltung grosse Uneinigkeit und Wildwuchs. In fast jeder seiner jährlich rund 70 Kesb-Beratungen seien Fälle ein Thema, in denen Massnahmen wegen fehlender Kostengutsprachen verzögert, erschwert oder verhindert werden. Das Bundesgerichtsurteil zum Fall Dübendorf stelle klar: Das Wohl des Kindes hat Vorrang vor anderen Interessen. Das Bundesgericht holt in diesem Punkt weit aus. Das Kindeswohl geniesse in der Schweiz Verfassungsrang, schreiben die Richter, es gelte als Maxime des Kindesrechts. Sie weisen darauf hin, dass der Kindesschutz in der Verfassung als Grundrecht verankert ist. Auch wenn dieser Verfassungsartikel nicht klagbar ist, so mache er den Kindesschutz doch zu einem vordringlichen Anliegen, und der Gesetzgeber sei damit angehalten, auf die Interessen von Kindern und Jugendlichen besondere Rücksicht zu nehmen.
Kindesschutz-Massnahmen seien rasch umzusetzen und «insbesondere nicht durch Konflikte über die Zuständigkeit der Kostenübernahme» zu verzögern. Für das Bundesgericht ist klar, dass die Sozialbehörde in Dübendorf zwar kantonales Recht eingehalten hat, namentlich das Sozialhilfe-Behördenhandbuch und die Verordnung zum kantonalen Sozialhilfegesetz, aber damit Bundesrecht verletzt hat.
Das Behörden-Handbuch wurde geändert
Wenig Freude an dem Urteil haben die Gemeinden. Die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich hat das Behördenhandbuch bereits angepasst. Dort heisst es jetzt:
«Ist nicht klar, dass die Eltern bereit oder in der Lage sind, die für eine ambulante Kindesschutzmassnahme anfallenden Kosten zu übernehmen, hat die Sozialbehörde daher direkte Kostengutsprache im Sinne einer vorläufigen Kostenübernahme zu leisten, um die rasche und effiziente Durchführung der angeordneten Kindesschutzmassnahme nicht zu gefährden.»
Jörg Kündig, Präsident des Gemeindepräsidentenverbands des Kantons Zürich und Gemeindepräsident in Gossau, hält das Urteil für «äusserst bedenklich». Einmal mehr werde eine nach bestem Wissen und Gewissen arbeitende Gemeindebehörde gerichtlich übersteuert, sagt er. Zudem werde das Subsidiaritätspinzip – erst die Eltern, dann Dritte, dann die Gemeinde – praktisch umgestossen. Eine Einzelfallprüfung und vorgängige Abklärung würden verunmöglicht.
Das Urteil führe auch zu einer noch stärkeren finanziellen Belastung der Gemeinden, sagt Kündig, die Inkassoverfahren seien heute schon mühsam und teuer und manchmal nur auf dem Rechtsweg durchführbar. Den Kesb sowie den Kinder- und Jugendhilfezentren ermögliche das Urteil hingegen, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Sie müssten sich nicht mehr mit den Gemeinden absprechen, sondern könnten «einseitig verfügen», was aber immer der schlechtere Weg sei.
Soziale Stellung sorgte für Ungleichbehandlung
Rechtsanwältin Noëlle Cerletti versteht den Frust des Gemeindevertreters teilweise. Trotzdem sei das Urteil richtig, denn anders könne das System nicht funktionieren, sagt sie. Kindesschutzmassnahmen seien in der Regel dringlich, etwa die Begleitung von Besuchen eines Kindes beim Vater oder wie im vorliegenden Fall ausserschulische Betreuung. Werde zuerst über die finanzielle Zuständigkeit gestritten, verhindere dies den wirksamen Kindesschutz und vereitle vollkommen dessen Zweck.
Stossend am bisherigen System sei auch die Ungleichbehandlung der Kinder aufgrund ihrer sozialen Stellung gewesen, sagt Cerletti: Wenn eine Familie von der Sozialhilfe lebte, haben Gemeinden sofort bezahlt. Wenn sie hingegen ein eigenes Einkommen erzielte, wie diejenige in Dübendorf, weigerten sich manche Gemeinden, die Kosten vorzustrecken. Bei den Kindern in Dübendorf führte dies dazu, dass sie nicht zum Schulzahnarzt gehen konnten, weil die Hortkosten längere Zeit nicht gedeckt waren.
(Tages-Anzeiger)
Urteil 8C_25/2018 vom 19. Juni 2018