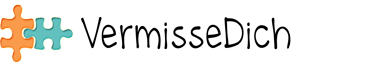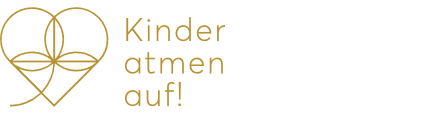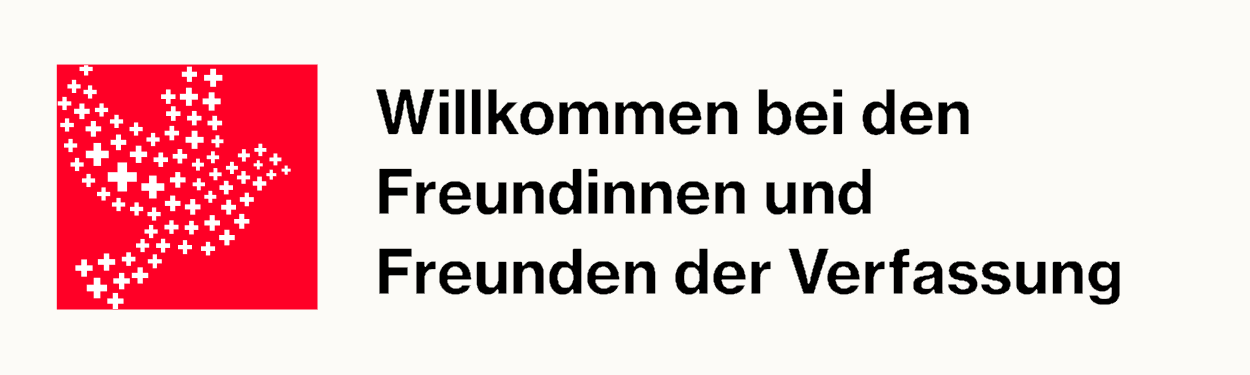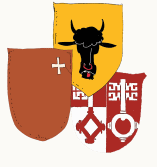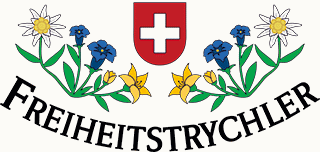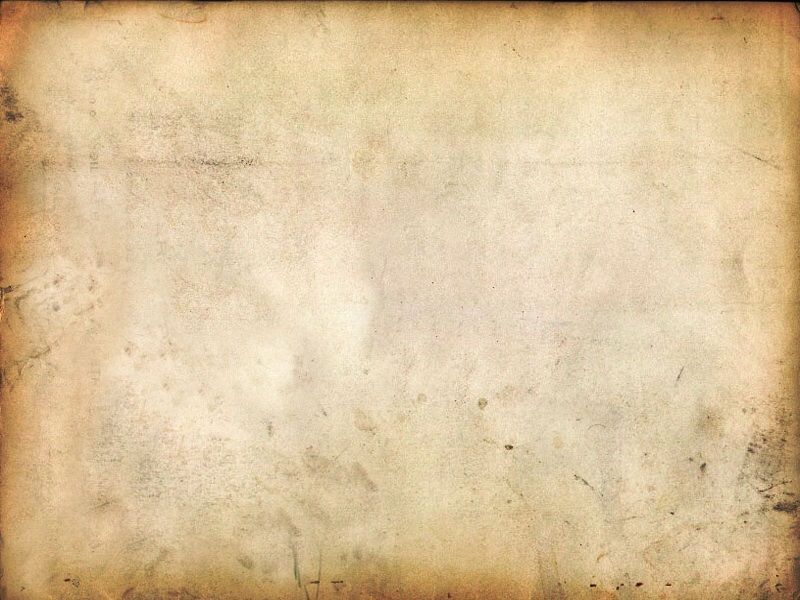Die Gemeinden wollen bei der Bestimmung der Kosten mitreden – Chefin der Sozialbehörde macht sich für Gütesiegel bei privaten Anbietern stark
Bern Eine «Familienstabilisierung» mit «intensivem Anleiten und Üben vor Ort» kostet 140 Franken die Stunde; für sechs Monate liegt auch die Pauschale zu 20 000 Franken drin. Die «Familienaktivierung» gibt es für 15 000 Franken. Die überforderte alleinerziehende Mutter von drei Kindern entscheidet sich für das erste Angebot. Anderer Fall: Einer Frau im Scheidungsprozess fällt es schwer, «erzieherische Grenzen zu setzen» und Verantwortung für ihr pubertierendes Kind zu übernehmen. Ein Jugendcoach springt für vier Stunden pro Woche ein. Für 2500 Franken im Monat. Einer Familie aus dem Sudan entgleitet die Erziehung der Tochter; sie wird für zwei Monate in ein spezielles Heim gebracht. Das schlägt mit über 30 000 Franken zu Buche.
Die genannten Beispiele lesen sich wie der Katalog aus einem sozialen Albtraum. Es handelt sich aber um reale, aktenkundige Beispiele aus Deutschschweizer Gemeinden. Sie existieren hundertfach im Land, und sie zeigen ein System der Sozialhilfe auf, das an falschen Anreizen krankt. All den obigen Fällen ist gemein, dass sie durch die öffentliche Hand finanziert sind, die Vergabekompetenz aber bei einer gesonderten Stelle liegt. Den Profit erzielen private Dienstleister. Das weckt Widerstände; vor zwei Wochen brachte der Fall der Zürcher Gemeinde Hagenbuch das Fass zum Überlaufen. Das 1000-Seelen-Dorf muss die Steuern erhöhen, weil die Betreuung einer siebenköpfigen eritreischen Flüchtlingsfamilie monatlich 60 000 Franken kostet.
Sozialfirmen entwickeln ständig neue Geschäftsfelder
Dass etwas schiefläuft, zeigen die Kosten für die Allgemeinheit, die im Verhältnis zur Wohnbevölkerung überproportional steigen: So sind etwa die Sozialausgaben aller 170 Gemeinden des Kantons Zürich zwischen 2002 und 2012 um 51 Prozent gestiegen. Die Wohnbevölkerung ist im selben Zeitraum aber «nur» um 13 Prozent angewachsen. Die Zahlen betreffen allein die Gemeindeausgaben; die Kantonsausgaben sind nicht berücksichtigt.
Gesamtschweizerisch wurden im Jahr 2005 noch 1,7 Milliarden Franken in der Sozialhilfe aus-gegeben. Im Jahr 2012 waren es 2,4 Milliarden Franken oder rund 40 Prozent mehr.
Die Anzahl Mitbieter um diesen Geldtopf steigt stetig – das Geschäftsmodell Sozialhilfe ruft Einzelfirmen genauso auf den Plan wie Millionenunternehmen. Die Anbieter bilden einen bunten Strauss; sie heissen zum Beispiel Solidhelp, Florhof, ORS, Bussla oder Mobile Familienberatung. Szenekenner berichten, wie sich die Branche immer neue Geschäftsfelder eröffnet – gerade Migranten und Asylsuchende aus fremden Kultur- und Sprachräumen bieten Möglichkeiten für Sozialfirmen, neue Dienstleistungen zu entwickeln. Interkulturelles Coaching, Begleitung sowie Beratung im Umgang mit neuen Technologien sind nur drei Beispiele.
Tausende von Franken, um eine Messie-Wohnung aufzuräumen
Die Firma Solidhelp hat im Fall von Hagenbuch 135 Franken pro Stunde verlangt, was auf massive öffentliche Kritik stiess. Es gibt aber deutlich höhere Ansätze in der Branche – der Zürcher Sozialarbeiter Röne Gerber etwa verlangt in der Stunde 180 Franken. Seine Dienste umfassen unter anderem Teamentwicklung, Coaching, Konfliktmanagement und Ausbildungsbegleitung. Gerber sagt auf Anfrage, dass er nicht nur in der Sozialarbeit, sondern auch als Aussendozent und im Gemeinwesen beschäftigt sei. «Ich habe grundsätzlich einen Standardansatz für alle drei Bereiche.» Pro Monat verdiene er rund 5000 Franken. Er mache nicht mehr als vier Aufträge gleichzeitig. Ausserdem tendiere er dazu, seine Geschäftspartner zu Pauschalverträgen zu motivieren. Gerber gibt ausserdem zu bedenken, dass er engagiert werde, wenn die anderen Angebote nichts gebracht hätten. «Wir haben die schwierigsten und anspruchsvollsten Fälle.»
Wie bunt das Angebot ist, illustriert die Firma Home Management. Sie ist ganz auf die Beratung von Messies spezialisiert. Das sind Menschen, denen die Fähigkeit fehlt, Ordnung in der eigenen Wohnung zu behalten und ihr Leben zu organisieren («Gemeinsam entscheiden wir, Gemeinsam entsorgen wir, Gemeinsam verräumen wir, Gemeinsam sind wir erfolgreich»). Auf seiner Homepage listet das Unternehmen eine Messie-Typologie auf: So wird etwa zwischen dem «erholungsbedürftigen», dem «sentimentalen», dem «perfektionistischen» oder dem «rebellischen» Messie unterschieden. Der SonntagsZeitung liegt der Fall einer Spanierin vor, die ge-mäss Akten eine «grobe Unordnung» zu Hause hat. Die Behörde hat für mehrere Tausend Franken den Einsatz der Spezialisten beantragt – Aufräumen zulasten der Allgemeinheit.
SVP will die Sozialhilfe komplett umkrempeln
Seit dem 1. Januar 2013 entscheidet nicht mehr die Vormundschaftsbehörde, die sich in der Regel aus lokalen Einwohnern zusammensetzt, über die Auftragsvergabe. Die neue Instanz in jedem Kanton heisst Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, kurz Kesb. Und seit einem Bundesgerichtsbeschluss wurde den Gemeinden bei Aufträgen an private Anbieter faktisch das letzte Wort entzogen. Die Finanzen dürfen in den Erwägungen keine Rolle spielen, wenn es um das Wohl von Sozialhilfebezügern geht, lautete das Verdikt aus Lausanne. Spätestens dann hat sich der Widerstand der Gemeinden formiert – es sind nicht nur Fälle aus Zürich, sondern auch aus den Kantonen Schaffhausen, Schwyz und Bern aktenkundig.
Eine parteiinterne Arbeitsgruppe der SVP hat diesen Sommer ein hundertseitiges Grundlagenpapier ausgearbeitet mit dem Ziel, die Sozialhilfe grundlegend umzukrempeln. Dabei ist auch der Zürcher Nationalrat Alfred Heer. Er wird stellvertretend zwei parlamentarische Initiativen im Rat einreichen mit dem Ziel, die Macht der Kesb zurückzudrängen. Das Zivilgesetz sei dahingehend zu ändern, «dass die Kesb keine Massnahmen für Personen gegen den Willen von Gemeinden anordnen können, welche solche zu finanzieren haben», heisst es im einen Vorstoss.
Mit der Änderung des Vormundschaftsrechtes habe sich in der Praxis gezeigt, «dass diese Behörden im Gegensatz zu den Gemeinde überfordert sind», so Heer. Private Firmen, «die sich eine goldene Nase verdienen», würden mit der Betreuung von Menschen betraut. Die zweite Initiative fordert, die Gesetzesrevision, die zur Schaffung der Kesb führte, rückgängig zu machen.
Auch Kesb steht Privatsektor skeptisch gegenüber
Diana Wider leitet die nationale Konferenz der Kesb. Sie teilt die SVP-Forderungen nicht, signalisiert gegenüber der SonntagsZeitung aber Skepsis gegenüber dem florierenden Privatsektor. Sie plädiert für ein nationales Zertifikat für Sozialfirmen. Der Zürcher Kesb-Vertreter Ruedi Winet sagt im Interview, dass seine Behörde die Leistungen der privaten Anbieter nicht direkt überwachen könne – «auch besteht eine gewisse Gefahr, dass zu viele Akteure in einem Fall drin sind», sagt er.
Dass das Volumen des Sozialmarktes anschwillt, erklärt Branchenvertreter Röne Gerber damit, dass die Problemstellungen «immer komplexer werden». Seit Einführung der Kesb habe er nicht mehr Aufträge.
Einig sind sich in einem Punkt alle: Das soziale Netz gehört zu den grössten Errungenschaften der Schweiz. Elendsviertel gibt es hier keine, auch nicht eine breite Unterschicht oder klassische Armutsmilieus. Wer fällt, landet in einem engmaschigen System aus staatlichen und privaten Stellen. Das hat natürlich seinen Preis.
Doch das System krankt an falschen Anreizen. (Reza Rafi und Simon Widmer)