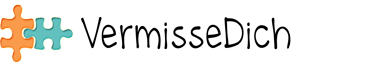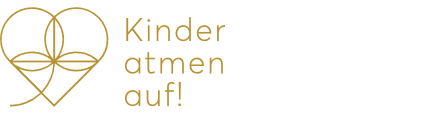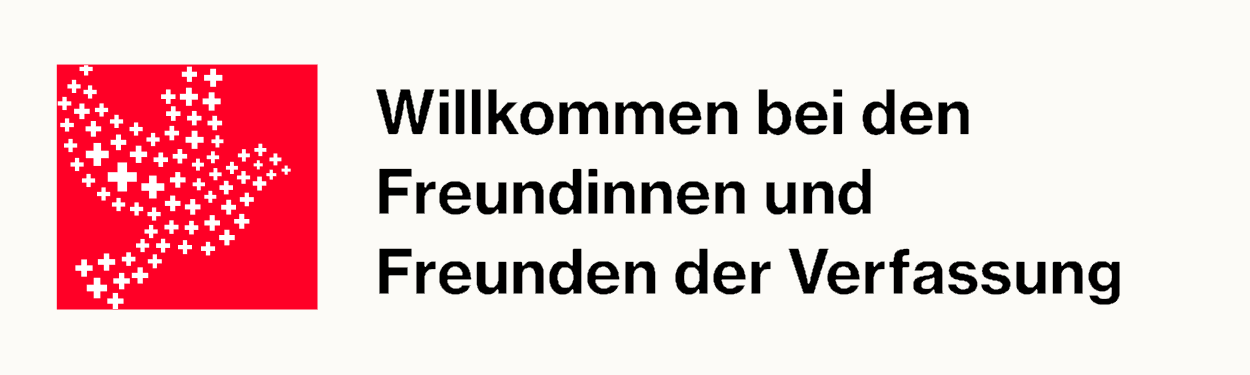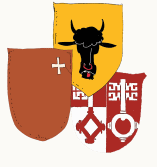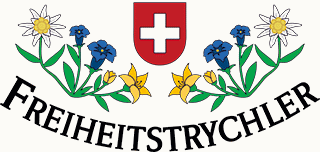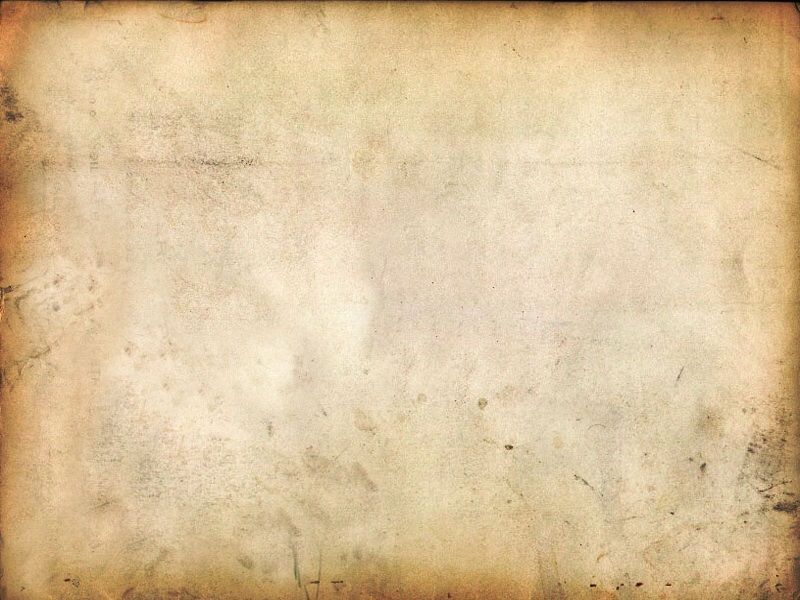Seit einem Jahr haben Eltern bei Trennung oder Scheidung das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder. Die Bilanz bisher: Der Streit um den Nachwuchs verlagert sich an eine neue Front.
Martin Büss* macht sich Sorgen. Seine Kinder hätten blaue Flecke, die nicht zu erklären seien, sagt er. Die Mutter der Kinder scheint labil, ihr neuer Partner ist ihm nicht geheuer. Büss sitzt auf seinem Bauernhof im Toggenburg und fühlt sich hilflos. Bald zieht seine Expartnerin aus dem Nachbardorf weg, in den Aargau, zu ihrem neuen Mann. Dann wird das Band zwischen Martin Büss und seinen zwei Kindern noch ein wenig dünner, «davon gehe ich aus».
Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) habe ihm nicht geholfen, findet er, habe «automatisch die Mutter priorisiert», gar nicht abgeklärt, ob das fünfjährige Mädchen und der dreijährige Bub auch bei ihm ein schönes Zuhause hätten. Dabei gehen sie in seinem Dorf zur Schule, einen Wechsel in den Aargau findet er unnötig. «Natürlich würde ich die Kinder sofort zu mir nehmen.» Aber die Mutter wolle das nicht.
Ein Fortschritt vor allem für die Väter
Seit vor einem Jahr das revidierte Sorgerecht in Kraft getreten ist, hat sich vieles verändert – aber nicht alles. «Die Angst, das Kind könnte einem weggenommen werden, hat sich mit der Revision zwar erübrigt», sagt Oliver Hunziker, Präsident des Vereins für elterliche Verantwortung. Die meisten Beratungsgespräche drehten sich heute aber um ein anderes Problem: um die Frage, wann das Kind in die Obhut welches Elternteils komme. Denn die gemeinsame elterliche Verantwortung auf dem Papier ist die eine Sache – wer das Kind aber von der Schule abholt, wann es ins Bett muss und ob es Computergames spielen darf, eine andere.
Rund 90 Prozent der Trennungen und Scheidungen in der Schweiz laufen unproblematisch ab. In den restlichen rund 4000 Fällen pro Jahr sind die Kinder hin- und hergerissen zwischen Elternteilen, die sich erbittert bekriegen – notfalls mit allen Mitteln.
Früher war es nicht möglich, das gemeinsame Sorgerecht zu erkämpfen – heute ist es fast unmöglich, es jemandem wieder abzusprechen. Ein Fortschritt vor allem für die Väter. «Das gemeinsame Sorgerecht ist ein Paradigmenwechsel, ein Meilenstein in der Elternfrage», meint Ivo Knill, Vizepräsident des Dachverbands der Schweizer Männer- und Väterorganisationen. Mit dem revidierten Gesetz werde endlich auch juristisch durchgesetzt, was sich in der Gesellschaft schon länger abzeichne: dass Eltern eben Eltern bleiben, jenseits von Liebe und Beziehung, «und dass beide die Verantwortung für das Kind gleichberechtigt tragen».
Die konkrete Umsetzung ist unklar
Männerorganisationen haben über Jahre für die Revision gekämpft. Und seit März 2015 ist Knill noch zufriedener: Künftig soll eine alternierende Obhut – also die geteilte Betreuung des Kindes – von Gericht oder KESB geprüft werden, auch wenn nur ein Elternteil diese beantragt. «Damit wird der Geist des gemeinsamen Sorgerechts erst richtig gelebt», so Knill.
«In Zukunft wird es mehr Streit um Erziehungsfragen geben.»
Patrick Fassbind, Präsident der KESB in Bern
Wie das konkret geschehen soll, wenn die Eltern sich partout nicht einigen wollen, weiss niemand. Es habe keine richtungweisenden Bundesgerichtsentscheide zu solchen Fragen gegeben, sagt Patrick Fassbind, Präsident der KESB Bern. Auch für ihn ist klar: Die Probleme haben sich mit der Gesetzesrevision schlicht in einen neuen Bereich verlagert. «In Zukunft wird es mehr Streit in Erziehungsfragen geben, weil diese einvernehmlich zu entscheiden sind.» Und wenn Eltern sich ständig zanken wegen Entscheidungen zu Religion, Einschulung, Freizeitaktivitäten, zu einem Umzug, sei
das Kindswohl noch mehr in Gefahr
als bei den altbekannten Besuchsrechtsstreitigkeiten.
Das neue Gesetz hat zwar keine Flut nachträglicher Anträge zum gemeinsamen Sorgerecht gebracht – wohl auch, weil viele Väter keine alten Wunden aufreissen wollten. Dennoch fressen Elternkonflikte bei den Kindesschutzbehörden Ressourcen auf. Oft dauere es Monate, bis ein Entscheid gefällt werden könne, sagt Fassbind. «Darunter könnten irgendwann die wirklich wichtigen Angelegenheiten leiden, etwa Kindsmissbrauch.» Durch die langen Entscheidungsprozesse leidet oft das Verhältnis der Kinder zu einem Elternteil. Und meist, so zeigt die Statistik, ist es die Beziehung zum Vater.
Die alternierende Obhut wird üblich
Patrick Fassbind kritisiert, der Gesetzgeber habe im Vorfeld der Sorgerechtsrevision zu wenig berücksichtigt, welche Folgen und Herausforderungen diese tatsächlich nach sich zieht. Die Umsetzung des neuen Rechts werde Jahre in Anspruch nehmen, und dabei würden neue politische Fragen auftauchen, zur Art der Betreuung, zur Art der Finanzierung. Und zur alles entscheidenden Frage: Was ist gut fürs Kind?
«Das Beste für das Kind ist die alternierende Obhut», sagt Martin Widrig, Rechtswissenschaftler an der Universität Freiburg. Das zeige die Forschung. «Den Kindern geht es gesundheitlich und psychisch besser, wenn sie bei beiden Elternteilen leben können. In vielen Fällen selbst dann, wenn die Eltern sich darüber nicht einig sind.» Widrig schreibt seine Dissertation zum Thema alternierende Obhut.
Und um die Obhut zufriedenstellend zu regeln, sei Mediation besser als ein Gerichtsverfahren – also die Beilegung von Konflikten in begleiteten Vermittlungsrunden. Als Erfolgsbeispiele führt Widrig Australien und Schweden an, wo der Staat Mediationen verordnet und teilweise auch bezahlt. «Innert fünf Jahren sind so die Sorgerechtsgerichtsfälle in Australien um 32 Prozent zurückgegangen.» Den Staat hätten die Mediationen faktisch weniger gekostet als die Gerichtsfälle.
Mit oder ohne Mediation: «Der Grossteil der Eltern einigt sich», sagt Ivo Knill vom Dachverband der Schweizer Männer- und Väterorganisationen.
In vielen Fällen seien sie auch an der gemeinsamen Obhutsregel interessiert, weil die Frauen sich heute beruflich engagieren wollten. «Wenn auch die Frau mehrere Tage pro Woche arbeitet, ist eine alternierende Obhut die beste Lösung für alle.» Hinzu käme auch eine wirtschaftliche Überlegung: Wer sich um das Kind kümmert, erhält neu einen Betreuungsunterhalt. Dessen Höhe und woran sie sich bemisst, müsse die Gerichtspraxis zwar erst noch feststellen. «Klar ist aber jetzt schon, dass für Väter ein grosser Anreiz besteht, sich aktiv an der Betreuung der Kinder zu beteiligen.»
«Der gerichtliche Weg ist aus meiner Sicht immer die schlechteste, teuerste, langsamste und unnötigste Variante.»
Oliver Hunziker, Verein für elterliche Verantwortung
Teuer zu stehen kommt in allen Fällen der gerichtliche Weg. «Das ist aus meiner Sicht immer die schlechteste, teuerste, langsamste und unnötigste Variante», sagt Oliver Hunziker vom Verein für elterliche Verantwortung. Auch aus psychologischen Gründen: Vor Gericht gibt es immer einen Gewinner und einen Verlierer – «eine Einstufung, die in Sorgerechtsfragen kontraproduktiv ist». Es liege in der Natur der Sache, dass es bei zwei Leben, die aufeinanderprallen, Reibung gebe. «Es gibt die Ansicht, man solle bloss keine Berührungspunkte schaffen, das verhindere den Konflikt. Das haben wir nun 40 Jahre lang so gemacht – ein Gewinn war das für niemanden.»
Künftig stehe im Vordergrund, dass die Eltern sich einigen müssen. «Und der Staat soll sie dabei unterstützen, sich zu arrangieren.»
*Name geändert
Autor: Anna Miller
26. Juni 2015, Beobachter 13/2015