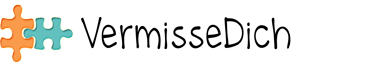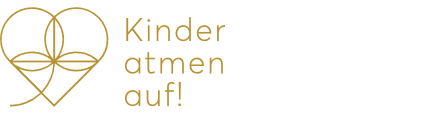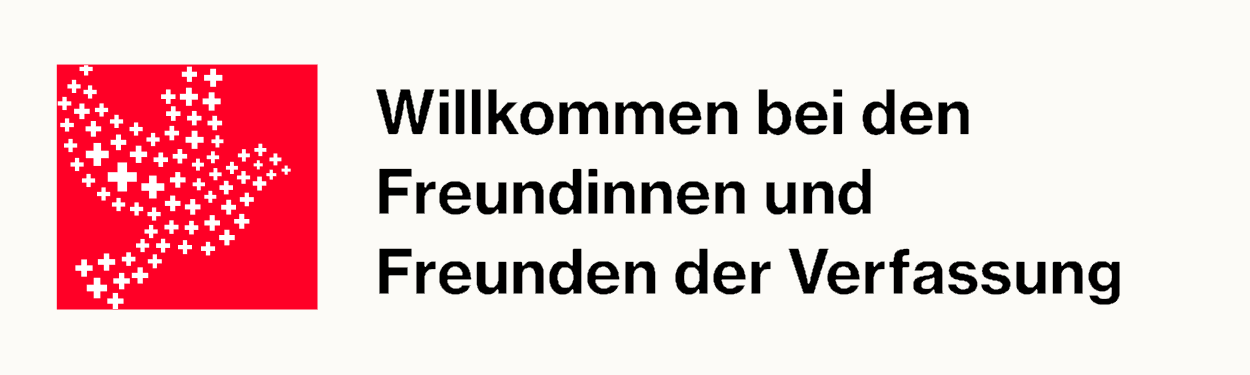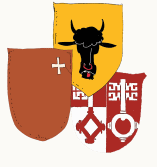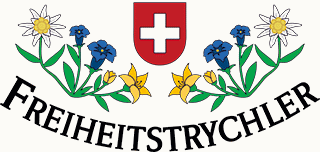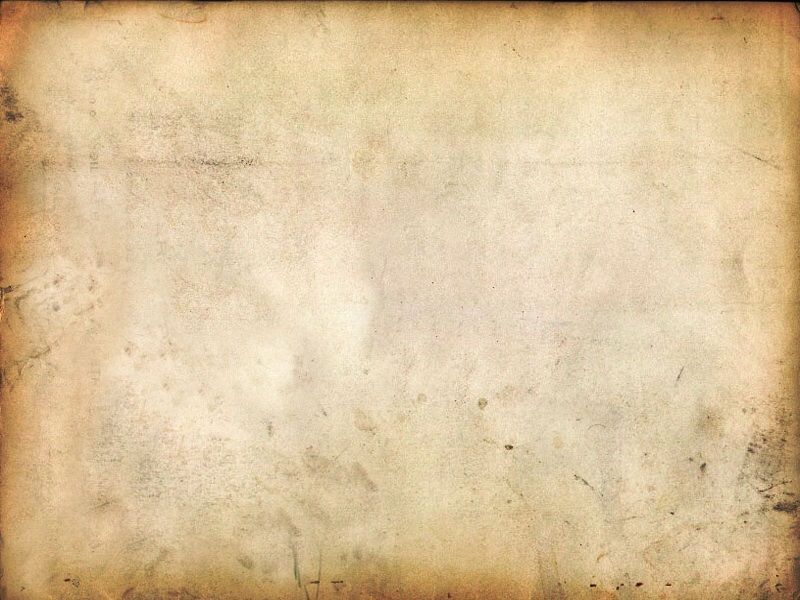Nach Kritik an der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde redet Kesb-Präsidentin Jacqueline Frossard.
Jacqueline Frossard, Sie sind Präsidentin der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Birstal. Haben Sie die Homepage «Stopp-der-Kesb-Willkuer.ch» schon besucht?
Nein.
Dort im Internet formiert sich Bürgerwiderstand gegen die Kesb. Man fordert grossmehrheitlich deren Abschaffung und organisiert sogar Mahnwachen. Das gab es früher nicht. Inwiefern sehen Sie eine Mitverantwortung Ihrer Behörde an diesen neuen Erscheinungen?
Wenn man nun für die Abschaffung der Kesb plädiert, dann hat das verschiedene Gründe: Generell steht die Kesb immer in einem Spannungsfeld – insbesondere bei Kindesschutzfällen – zwischen zwei Parteien, die sich nicht verstehen. Diese Streitigkeiten werden auf die Kesb projiziert. Im Weiteren haben die Gemeinden ein Stück weit ihre Autonomie verloren und müssen Kosten übernehmen, die sie nicht selber kontrollieren können. Das ist stossend und wäre zu optimieren. Dies ist aber nicht Sache der Kesb, sondern der Politik. Hinzuzufügen ist, dass Wahlen sind; mit dem Thema Kesb kann man sich leider sehr gut in Szene setzen. Und wenn wir die Argumente in Bezug auf die Kosten unter die Lupe nehmen, stellen wir fest, dass oft Zahlen genannt werden, die mit der Kesb gar nichts zu tun haben.
Was zum Beispiel?
Da werden Kosten der Kesb zugeschrieben, die beispielsweise die Strafverfolgungsbehörden ausgelöst haben. Ebenso fälschlicherweise wird die Kesb für Kosten der Sozialhilfe verantwortlich gemacht.
Wir würden sagen, dass das Vertrauen in Ihre Behörde auch deshalb angeschlagen ist, weil die Kesb nicht demokratisch gewählt ist.
Wie muss ich das verstehen?
Einen Gemeinderat, der früher die Vormundschaftsbehörde präsidierte, konnte man abwählen. Er war im sozialen Milieu eines Dorfes eingebunden und musste unverständliche Entscheide in der Dorfbeiz rechtfertigen können.
Wir sind auch kontrolliert. Wenn einer unserer Mitarbeiter ausscheren und unsere Klienten unfair behandeln würde, könnte man sich bei der Aufsichtsbehörde, bei Franziska Vogel Mansour, Hauptabteilung Recht der Sicherheitsdirektion in Liestal, beschweren. Und unsere Entscheide können vor Gericht angefochten werden. Es mag zutreffen, dass früher die Vormundschaft demokratisch gewählt wurde. Das waren oft Einzelne, die ihre Entscheide autark gefällt hatten. Heute hingegen entscheiden wir im Spruchkörper immer zu dritt. Da kann eine Person nicht ausscheren, da sie von den beiden anderen überstimmt würde.
Die Kritik, dass die Kesb eine Behörde ist, welche die Bodenhaftung verloren habe, flammt heute stärker denn je auf. Wie erklären Sie sich das?
Das kann ich nicht nachvollziehen. Wir stehen alle im Leben, die Teammitglieder diskutieren in der Kaffeepause über Erziehungsprobleme, die sie mit ihren Kindern haben. Ich selber habe trotz zweier Studien – zuerst Psychologie, dann Jura – auch als Verkäuferin im Jelmoli und als Zeitungsverträgerin gearbeitet. Ich war über 20 Jahre Psychotherapeutin und habe als Notfallpsychologin bei der Polizei in Basel gearbeitet. Was ich damit sagen will: Wir kennen das Leben.
Haben Sie auch Kinder?
Nein, aber die Hälfte unseres Teams sind Eltern. Ich selber arbeitete 20 Jahre lang mit ehemaligen Kindern – mit psychisch belasteten Erwachsenen.
Es heisst, dass das Kesb-Team die Gesellschaft möglichst breit abbilden soll – dies unter dem Stichwort Diversität. So wie uns die Fälle zugetragen werden, vertritt aber immer nur eine Sachbearbeiterin den Fall. Wird bei der Kesb «Diversität» nur auf dem Papier gelebt?
Es gibt eine Fall-führende Person. Aber bei uns werden die meisten Verfahrensschritte auch im Team besprochen. In diesen Fällen ist es nicht so, dass ein Sachbearbeiter im Team einfach das «Ja» abholt. Die Anforderungen an Mitglieder im Spruchkörper sind zudem sehr hoch. Anfügen möchte ich: Keine Kinder zu haben, bedeutet nicht, keine Lebenserfahrung zu haben. Wir stellen bewusst auch Mitarbeiter ohne Kinder ein, denn das ist auch eine Lebensrealität, die in der Kesb widerspiegelt werden soll.
Prominenteste Kesb-Gegnerin ist die Schriftstellerin Zoë Jenny. Wie beurteilen Sie ihre Tätigkeit?
Ihren Auftritt in der Arena vom Schweizer Fernsehen fand ich ehrlich gesagt etwas peinlich. Sie ist natürlich selber unmittelbar von einem Kesb-Entscheid betroffen. Dieser widerspiegelt die Sichtweise einer Person zu einem Fall, in dem die Kesb nicht das gemacht hat, was Zoë Jenny möchte. Sie beklagt, die Kesb lasse sich instrumentalisieren. Aber bitte: Die Kesb ist verpflichtet, sich einer Frage wie Vater-Kind-Kontakt anzunehmen, wenn der Vater dies beantragt. Und um einen Entscheid kann sich dann unsere Behörde nicht drücken.
Die BaZ hat die Kesb Birstal auch kritisiert – im Obhutsentzugs-Fall Habiba Mallem. Wir gehen davon aus, dass uns alle Akten zur Verfügung gestellt wurden. Und die zeigen, dass die Kesb ihren Entscheid mit wenig Substanz begründet hat: mit Unpünktlichkeit und aggressivem Verhalten des Kindes an der Schule. Zusammengefasst mit «strukturellen Familienproblemen». Reicht das heute, um einer Mutter das Kind wegzunehmen?
Glauben Sie wirklich, wir hätten nichts anderes zu tun, als Kinder ins Heim zu stecken, weil sie unpünktlich sind?
Leider geben Ihre Akten nicht viel mehr Substanz her. Darum müssen wir nochmals grundsätzlich fragen: Reichen aggressives Verhalten und Unpünktlichkeit für den Einsatz des strengsten Mittels, des Obhutsentzugs?
Man muss den Gesamtzusammenhang im Blick haben. Wenn man zum Schluss kommt, dass das Kind in seiner Entwicklung gefährdet sein könnte, dann ist nähere Abklärung angebracht. Wir nehmen den Eltern damit noch immer nicht die Kinder weg. Wir überlegen uns den Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts, wie es heute heisst, gründlich. Wir wissen, dass dies ein massiver Eingriff in das Familiensystem bedeutet, und haben vorher mildere Alternativen geprüft.
Wie Ihre Kesb schreibt, liegen im Fall Mallem strukturelle familiäre Probleme vor, und vielleicht zeigt sich die Frau tatsächlich auch unkooperativ im Umgang mit der Kesb. Nun wird Ihnen der Vorwurf gemacht, dass früher die Behörden den Zigeunern mit genau denselben Argumenten die Kinder wegnahmen – unter dem Titel «Kinder der Landstrasse».
Der Vorwurf wurde in der BaZ von einer Person geäussert, die sich anmasst, die Situation der Familie zu kennen. Ein Vergleich mit dem Projekt «Kinder der Landstrasse» entbehrt jeder Grundlage und ist absurd. Es ist schwierig für mich, in dem erwähnten Fall vertiefend zu argumentieren, weil wir als Behörde ans Amtsgeheimnis gebunden sind. Ich kann nur nochmals betonen: Obhutsentzug wegen Unpünktlichkeit würden wir nie durchführen.
Packen wir das Problem von einer anderen Seite an: Wenn Sie ein Kind in ein Heim einweisen, können Sie davon ausgehen, dass es von Experten betreut wird. Sie befinden sich auf der sicheren Seite, während Sie sich bei Eltern nie absichern können. Inwiefern beeinflusst diese Tatsache Ihre Entscheidungsfindung?
Unsere Entscheidungsfindung richtet sich danach, was für das Kind gut ist.
Es kommt doch vor, dass auch Sie das nicht wirklich wissen.
Richtig. Darum schauen wir genau hin, ob ein Verhalten eine vorübergehende Erscheinung ist, ob es sich um eine Krise handelt oder um etwas Grundlegenderes. Wenn wir nicht schlauer werden, lassen wir das Kind abklären, wobei die Abklärung primär ambulant erfolgt, bei einem ambulanten Psychiatrischen Dienst beispielsweise. Wenn die Eltern aber nicht mitmachen, müssen wir Kinder für eine gewisse Zeit platzieren – wohlgemerkt für eine begrenzte Zeit.
Es gibt Eltern, die klagen, dass Ihre Kinder in diesen Heimen alkohol- und drogenabhängig geworden oder ihre Töchter gar in der Prostitution gelandet sind. Sind Heime ein sicherer Ort für Kinder?
Wir wissen, dass Kinder grundsätzlich zu Hause bleiben wollen. Das ist auch unsere Richtschnur. Ohnehin müssen wir von Gesetzes wegen die mildeste Massnahme einleiten.
Haben Sie von den Heimen, denen Sie Kinder zuweisen, einen Qualitätsreport, der Auskunft gibt, wie sich die Kinder nach deren Heimaufenthalt entwickelt haben?
Nein. Zahlen haben wir nicht; sie wären wahrscheinlich auch nicht hilfreich. Wenn ich das von den Abgängern erfahren möchte, hätte ich ein Bild des Heimzustandes in der Vergangenheit. Sie müssen wissen: Wir verfügen Heimeinweisungen höchst selten, und wenn, meistens nur für eine begrenzte Zeit. Wie gut es einem Kind in einem Heim geht, das ist immer auch vom Kind abhängig. Während meiner früheren Arbeit habe ich Kinder kennengelernt, die im Heim gelitten haben, und andere, die darin aufgingen.
Inwiefern spüren Sie die unmittelbare Verantwortung für einen allfälligen Fehlentscheid?
Wir haben unsere Werkzeuge – ich weiss, ob ein Entscheid auf gut abgeklärten Grundlagen beruht oder nicht. Und wir haben eine moralische Verantwortung und verantworten unsere Entscheide vor Gericht.
Trifft der Eindruck zu, dass die Behörden mehr Sicherheit und mehr Abklärungen verlangen als vor einigen Jahren?
In aller Munde ist das Wort «Nulltoleranz» – bestimmt gegenüber Gewalt. Das hat sicher einen Einfluss. Wir fühlen uns aber nicht in dem Sinne der Gesellschaft verpflichtet, dass wir Strömungen mitmachen. Dennoch orientieren wir uns am gesellschaftlichen Wertesystem, das auch unsere Gesetzgebung prägt. Früher wurde mehr zugelassen – es wurde aber auch weniger geschützt. Mit anderen Worten: Kinder konnten früher massiv gequält werden, ohne dass es jemanden zu kümmern schien. Heute, so glaube ich, schaut der Staat intensiver hin.
Zurück zu den explodierenden Kosten: In Buckten sind sie seit Einführung der Kesb um 900 Prozent gestiegen. Ist die Einsetzung der Profi-Behörde in Anbetracht dieser Steigerung gerechtfertigt?
Bei kleinen Budgets sind Prozentrechnungen immer trügerisch. Aber Sie haben recht: Für kleine Gemeinden ist es ein grosses Problem. Hier braucht es neue politische Lösungen. Stossend ist für mich, dass die Gemeinden mildere Massnahmen wie die Einsetzung einer sozialpädagogischen Familienbegleitung als direkte Unterstützung in der betroffenen Familie bezahlen müssen, während die «harten» Massnahmen, wie die Heimplatzierung, vom Kanton berappt werden. Wir sind zu Recht gesetzlich verpflichtet, mildere Massnahmen zu priorisieren, mit der Folge, dass Gemeinden diese bezahlen müssen, wenn Eltern das nicht können.
Im Nationalrat arbeiten Kräfte für die Aufhebung der Kesb. Wann werden Sie abgeschafft?
Wir werden ganz sicher nicht abgeschafft. Der Staat hat nämlich die Pflicht, sich um Leute zu kümmern, die dies nicht selber tun. Wir reden hier auch von den Erwachsenen. Und ein Zurück zum alten System wollen weder die Fachleute noch die Gemeindevertreter. (Basler Zeitung)
Gericht stützt Kesb-Entscheid im Fall Habiba Mallem
Es ist ein aussergewöhnlicher Fall, den die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Birstal führt: Wegen «struktureller Probleme in der Familie» wurde der Mutter Habiba Mallem aus Muttenz die Obhut über ihre jüngste Tochter entzogen. Dies aufgrund einer nicht näher begründeten Gefährdungsmeldung der Schule, als dass die Tochter durch aggressives Verhalten und Unpünktlichkeit aufgefallen sei. Auch habe man die Tochter nachts um 22 Uhr draussen gesehen. Das sei am 1. August und an Halloween gewesen, wehrte sich die Mutter, die einen perfekten Haushalt führt. Sie bestreitet, das Kind zu vernachlässigen. Ihre Beschwerde gegen den «Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts» wurde vom Kantonsgericht am 7. Januar unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Dem Anwalt von Mallem liegt das Dispositiv vor, das Urteil jedoch noch nicht. Vorweg kann gesagt werden, dass die Beschwerde abgelehnt worden ist; das Gericht stützt die Kesb im Entscheid des Obhutsentzugs. Die Begründung falle mutmasslich so aus, dass es unverhältnismässig sei, die Massnahme des provisorischen Obhutsentzugs abzubrechen. Eine weitere Abklärung werde im Kindesinteresse sein, damit eine Massnahme angeordnet werden könne, teilt der Anwalt mit, der den staatlichen Eingriff in diesem Fall als krass unverhältnismässig taxiert.