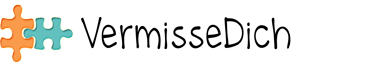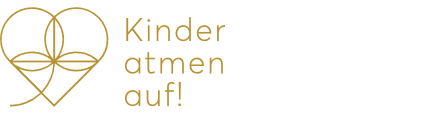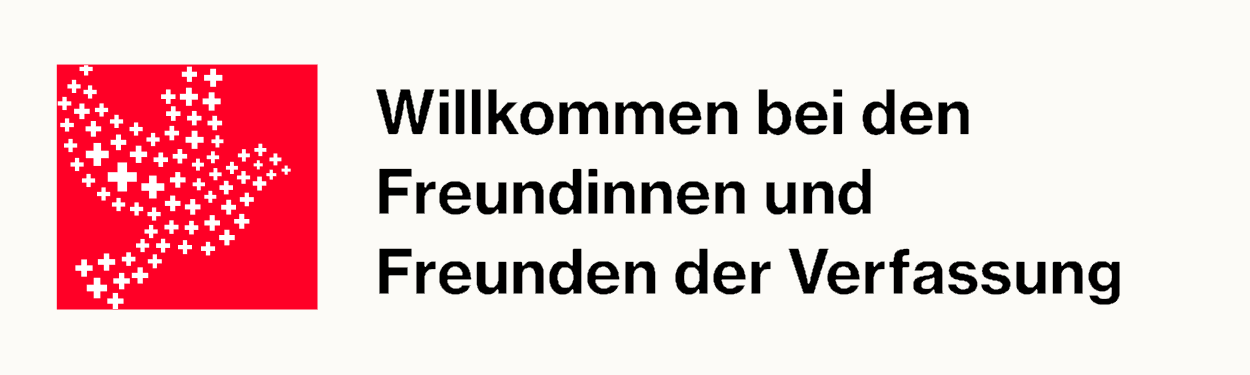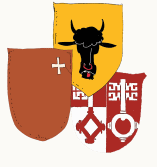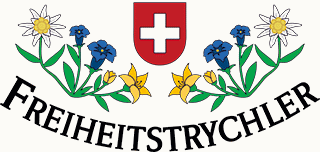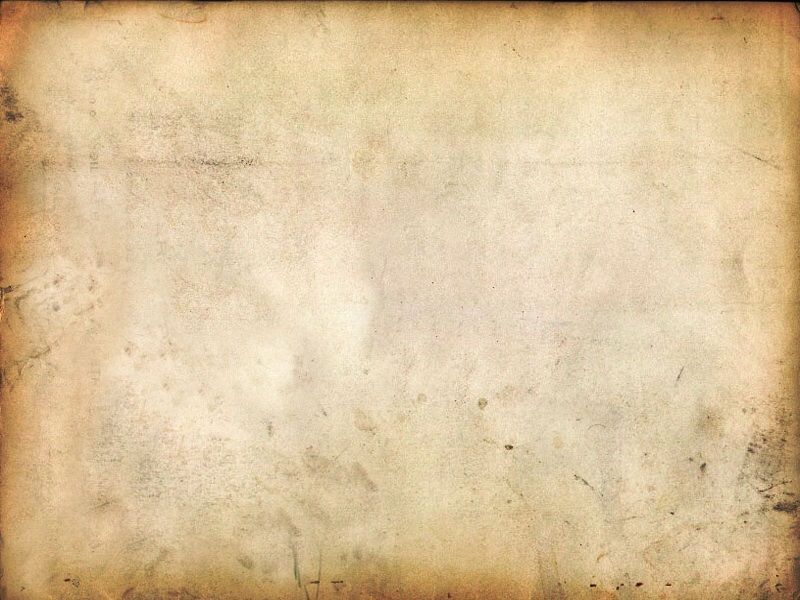Appellationsgericht pfeift Kesb Basel-Stadt zurück. Behörde wollte Neunjährige in Heim platzieren
«Das Kindswohl gilt als gefährdet bei Vernachlässigung, körperlicher oder psychischer Misshandlung oder sexuellem Missbrauch.» So deklariert die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) ihre Legitimation, als staatlicher Apparat in familiäre Verhältnisse eingreifen zu dürfen. Im Fall von Melanie Huber* war keine dieser Voraussetzungen nachweislich erfüllt. Da waren eine fürsorgliche Sozialpädagogin und ihre wohlerzogene Tochter. Trotzdem versuchte die Kesb Basel-Stadt unter der Leitung von Patrick Fassbind, das Kind in ein Heim zu stecken.
Das Appellationsgericht hat dem Experiment ein Ende gesetzt. Der Entscheid wurde Ende November gefällt, die Presse von der Verhandlung ausgeschlossen. Das schriftliche Urteil ist erst diesen Monat zugestellt worden. Der zentrale Inhalt: Das Kind darf nicht fremdplatziert werden.
Bevor der Hintergrund dieser Geschichte erzählt werden kann, noch eine Vorbemerkung: Die BaZ verfügt über hinreichend Material inklusive Gutachten und Verhandlungsprotokolle, um sich ein Bild zur Entscheidungsfindung machen zu können. Zahlreiche Zeugnisse von Lehrern und Ärzten liegen vor, es war möglich, mit dem Umfeld der Familie zu sprechen und Einblick in den Haushalt von Melanie zu nehmen. Letzteres hat die Kesb übrigens unterlassen.
Am Montag früh kam die Behörde
Gemäss einschlägiger Lehre sind Fremdplatzierungen, wie es die Behörde vorsah, für das Kind traumatisierend und sollten nur im äussersten Notfall verfügt werden. Doch die Kesb wollte mit der Zwangsmassnahme «Neuland» betreten, wie es Fassbind ausdrückt, um die Beziehung zum Kindsvater zu erzwingen. Ein Kontakt, der schon längst gestört war. Um das neunjährige Mädchen umzustimmen, sollte das Umfeld gemeinsam gegen den Willen des Kindes eingeschworen werden. Der beauftragte Gutachter hatte es so programmatisch vorgeschlagen.
Das Erlebnis am Montag, 19. März 2018, hat sich im Gedächtnis von Melanie Huber und ihrer Tochter unwiderruflich eingeprägt. An diesem Morgen um sieben Uhr klingelten eine Vertreterin der basel-städtischen Kesb und die Beiständin an der Haustür auf dem Bruderholz und wollten die Tochter bei dieser Blitzaktion mitnehmen, bevor diese zur Schule ging. Keine Trennungsvorbereitung, keine Abmeldung vom Schulprogramm. Und wohin es mit dem Mädchen gehen sollte, konnten oder wollten die beiden Frauen vor Ort nicht sagen. Von Notfallplatzierung war die Rede. Die Damen hatten an jenem Tag einfach den Kesb-Entscheid umzusetzen, der am Freitag vor dem Wochenende gefällt worden war.
Es war ein Entscheid, ohne die Mutter oder das Kind angehört zu haben. Nicht einmal das Rechtsmittel der Beschwerde wurde der Mutter eröffnet. Und in all den Jahren verpasste es die Behörde, die Rolle des Vater auszuleuchten, um eine Antwort zu finden, weshalb sich das Kind gegen seine Besuche wehrt. Aus diesem Grund ist in den Unterlagen zum Vater nahezu nichts vorhanden. Er verhalte sich dem Kind gegenüber feinfühlig, stellen die Behörden immerhin fest.
Gutachter spielt sich auf
Die Kesb stützte sich bei ihrem «Geheimentscheid» drei Tage zuvor auf den umstrittenen Berner Fachpsychologen und Gutachter Daniel Gutschner ab, der gerne auch mal vom Verein Väterlobby vorgeschlagen wird und schon Thema im Beobachter-Forum war. Die von der Kesb eingesetzte Kindsanwältin – wie aus dem Verhandlungsprotokoll hervorgeht – war «erschrocken über seine Empfehlung der Fremdplatzierung», weil «nie zur Diskussion stand, dass die Kindsmutter es selbst nicht gut mache.
Aber diese Bedenken konnte der Gutachter im Verlauf seines Auftritts geschickt zerstreuen, indem er insinuierte, es gehe dem Kind nicht gut: «Das Kind muss Anrecht haben auf Spass, wenn es von der Schule heimkommt. Aber die Tochter muss immer überlegen, was sie sagen darf», erklärte er der Kesb. Nach solchen Sätzen mussten die Behördenvertreter unweigerlich den Eindruck erhalten, die Mutter sei die Spassbremse im Leben des Kindes. Zeichnungen des Kindes und Fotobände zeigen das Gegenteil.
Um die Bedenken bezüglich Fremdplatzierung vollends zu zerstreuen, schwor Gutachter Gutschner alle auf eine einheitliche Linie ein: «Es (die Heimplatzierung, Anm. d. Red.) ist ein Schock für das Kind. Es muss die Sicherheit haben, dass alle dahinterstehen. (…) Man muss der Tochter sagen, dass die Leute drum herum die Meinung haben, dass es bisher nicht gut war. Der Verlauf ist unserer Erfahrung nach sehr positiv. Auch wenn ein Elternteil ein Kind drei Jahre nicht gesehen hat.»
Und dann fügte er hinzu, dass ein Selbstmord der Mutter, gar ein erweiterter Suizid wie im Fall Flaach, nicht ausgeschlossen werden könne, würde man ihr das Kind wegnehmen. Gutschner trug ohne Diagnosegrundlage vor, aus dem heiteren Himmel.
Weshalb die beiden Damen ihre Übung an jenem Märzmorgen dennoch abbrachen und ohne Kind abzogen, bleibt ihr Geheimnis. Eine Aussage dazu machen sie nicht. War es die Erkenntnis, dass wohl doch keine akute Gefährdung vorlag? War es die hier unbegründete Furcht vor einer Wiederholung eines «Falls Flaach», wo die Mutter die Kinder in den Tod riss? War es die demonstrative Fassungslosigkeit der Mutter und die blitzschnelle Reaktion des beauftragten Anwalts Hans M. Weltert aus dem Kanton Aargau, der darauf hinwies, dass man einen Entscheid nicht vollziehen dürfe, wenn er nicht rechtskräftig ist – insbesondere dann nicht, wenn keine Gefahr in Verzug ist? Oder hatten die Kesb-Damen letztlich doch ein Mutterherz? Wir wissen es nicht. Aber am 19. März blieb eine «vergellsterte» Neunjährige zurück, die die Mama bald täglich fragte:
«Gäll, hüt kömme sii mi nid go hole?»
Diese traumatisierende Intervention der Kesb Basel-Stadt hat eine siebenjährige Vorgeschichte. Im Alter von zwei Jahren habe das Töchterchen sexuelle Handlungen nachgeahmt und weitere Aussagen zum Vater gemacht, die nur Misstrauen wecken konnten und auch den Kinderarzt alarmierten. Der Verdacht von sexuellen Übergriffen stand im Raum. Dieser wurde aber nie erhärtet. Aber langsam begann sich das Kind gegen die Besuchsrechtsausübungen des Kindsvaters zu sperren. Das Töchterchen wollte nicht mehr hingehen; nicht mehr regelmässig, nicht mehr häufig und schon gar nicht unbegleitet. Es kam vor, dass Melanie Huber ihre Tochter weinend zum Kindsvater tragen musste, damit sie ihrer Pflicht, das Besuchsrecht des Vaters zu ermöglichen, nachkommen konnte.
«Und irgendwann konnte ich das einfach nicht mehr mittragen», sagte Huber. Der Vater denkt, das Kind unterliege einer Gehirnwäsche, wie er vor Gericht zum Ausdruck brachte.
In der Argumentations-Falle
Nun begann der Spiessrutenlauf bei den Behörden und Gerichten. Besuchsbeistände, Kinderanwältin, Psychologen und Gutachter wurden installiert. 63 Stunden ihres Lebens musste sich das Kind bereits vor Behörden erklären. Und dann fragten sich die Fachleute, weshalb das Kind derart trainiert sei, seine Wünsche so gewählt auszudrücken.
Die Mutter befand sich in der Falle: Sie sei es, die ihrer Tochter die Worte in den Mund legen würde. Melanie Huber sagt: «Je mehr ich zu vermitteln versuchte, desto mehr wurde mir Kontrollwahn vorgeworfen.»
Es gibt – wie die Dokumente hergeben – aber keine äusseren Merkmale und keine Beobachtung, wonach die Mutter ihr Kind dahingehend manipulierte, den Vater nicht zu besuchen. Während das Umfeld die 40-Jährige als umsichtige und konziliante Mutter schildert, die als Arbeitstätige bis zur Selbstaufopferung alles unternommen habe, die Termine wahrnehmen zu können, ziehen die Experten Analogien zu anderen Fällen. Ein Kind, das auf diese Art auf Distanz zum Vater gehe, müsse instrumentalisiert worden sein.
So schildert es auch der Vater: Die Mutter und ihre Familie würden den Kontakt zu ihm seit Jahren torpedieren. Er stellt in Abrede, dass das begleitete Besuchsrecht etwas mit seinem Verhalten oder seinen Fähigkeiten als Vater zu tun habe. Aufgefallen ist den Behörden, dass sich das Kind zuerst sperrte, an Gesprächen zu partizipieren, dann aber – ohne Gegenwart der Mutter – mit der Zeit auftaute. Auf solchen Beobachtungen gründet die Annahme, die Mutter würde den Kontakt zum Vater verweigern.
Schiffbruch auf Neulandsuche
So wollte die Kesb ein Exempel statuieren. Leiter Patrick Fassbind begründet es so: «Bundesgerichtliche Rechtsprechung unter der neuen gesetzlichen Ägide gibt es kaum, weshalb es an den kantonalen Entscheidbehörden liegt, eine Praxis dazu zu entwickeln. Hier wird also Neuland betreten.» Es werde letztlich am Bundesgericht sein zu entscheiden, wie sich die erhöhte väterliche Verantwortung im Hinblick auf das Recht des Kindes auf Kontakt zu beiden Elternteilen auf die Entscheid- und Vollzugspraxis der Kindesschutzbehörden und Gerichte auswirken wird.
Die von der Kesb eingesetzte Kinderanwältin stellte sich erst in der Schlussphase gegen die Kesb und nahm Partei für das Mädchen. Für Anwalt Hans M. Weltert ist das unbegreiflich: «Seltsamerweise müssen Kinderanwälte nicht auf die Wünsche ihrer Klienten, der Kinder, eingehen. Sie können ihre eigene Ansicht als objektiviertes Kindesinteresse darstellen.» Darum stellt er sich die Frage, ob auch hier von Klientenverrat und Verrat an der Treuepflicht gesprochen werden muss.
Aber der Anwalt lobt auch das Appellationsgericht, das nicht einfach aufgrund von Akten entschieden, sondern die Mutter vorgeladen hat. Gerichtspräsident Stephan Wullschleger habe sogar im Vorfeld der Verhandlung mit dem Kind selber gesprochen. Das sei mit Blick auf die Gerichtspraxis in anderen Kantonen nicht selbstverständlich.
Am 28. November 2018 hat das Basler Appellationsgericht den Entscheid der Kesb zu einer Fremdplatzierung aufgehoben. Ebenso die bestehende Regelung des Besuchsrechts. Die Mutter muss aber bis Februar 2020 Massnahmen zur Verbesserung der Vater-Kind-Beziehung umsetzen. Wie sie das erreichen will, ist ihr noch ein Rätsel.
Etwas ratlos bleibt letztlich auch Weltert zurück: «Die Behörden ordnen eine Fremdplatzierung an, ohne die Verfahrensrechte zu garantieren. Dass sie sich selbst disqualifizierten, ist vor diesem Hintergrund verständlich», sagt er.
Fassbind, der mit einem «Neuland-Experiment» das Vater-Kind-Verhältnis zu verbessern versuchte, bemerkt:
«Ich wünsche niemandem, die Erfahrung machen zu müssen, einem erziehungsfähigen Elternteil mitzuteilen, dass er aus Verhältnismässigkeitsgründen leider keinen Kontakt zu seinem Kind haben kann und akzeptieren muss, dass er sein Kind verloren hat beziehungsweise dieses aufgeben muss.»
Man muss genau lesen, um festzustellen, wen Patrick Fassbind letztlich mit seiner Aussage «ich wünsche niemandem …» adressiert: Es ist sein Kesb-Apparat – die Wünsche richten sich nicht an seine Klienten und noch weniger an das Kind.
*Name geändert
Quelle: Basler Zeitung