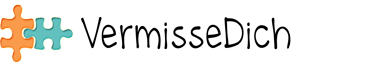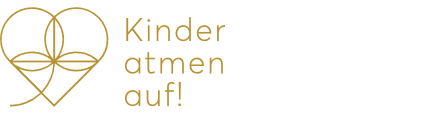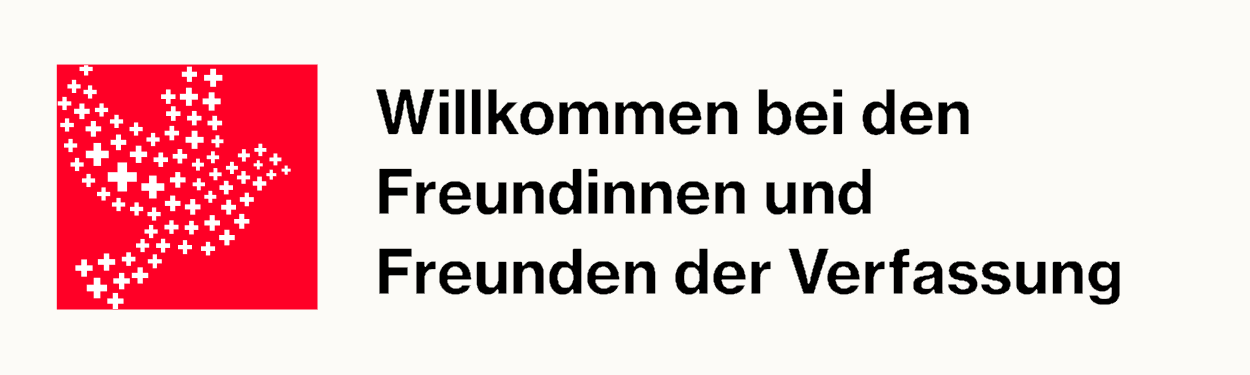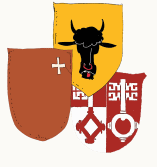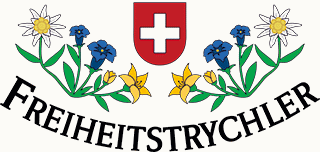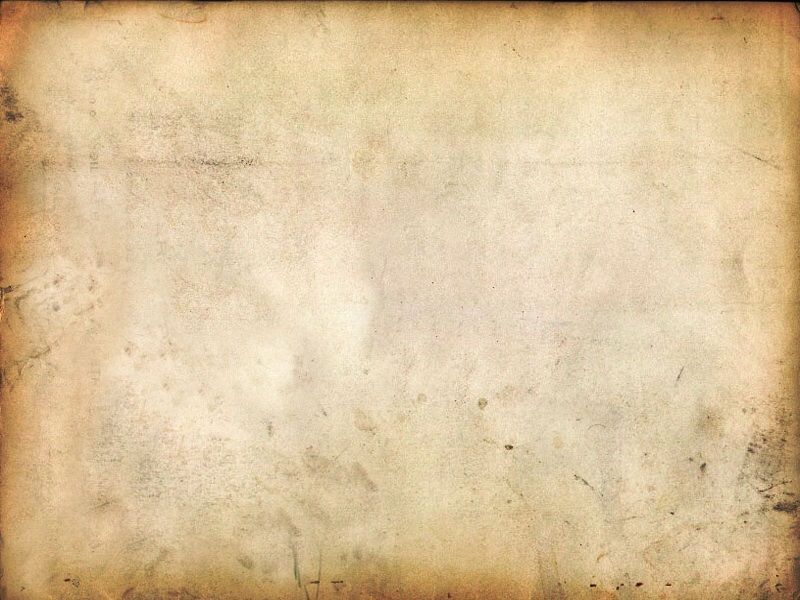Die Scheidungskämpfe um die Kinder werden härter – jetzt diskutiert das Bundesamt für Justiz über eine Änderung im Familienrecht
Jede zehnte Trennung in der Schweiz endet in einem erbitterten Kampf um das Kind. Dies treibt die Zahl der Kindesschutzmassnahmen in die Höhe, beschäftigt Anwälte, Gutachter und Gerichte.
Das letzte Mal, als Patrick Widmer mit seiner Tochter gesprochen hat, trug sie ihr blondes Haar zu zwei Zöpfen geflochten, die Fingernägel waren rosa lackiert. Etwas mehr als fünf Jahre zählte das Mädchen, das sich an diesem Maitag 2019 in einem Besuchstreff im Kanton Schwyz hinter den Beinen seiner Beiständin versteckte.
Ein ganzes Jahr hatte es seinen Papa zuvor nicht mehr gesehen. Dutzende von E-Mails hatte der Vater, der zum Schutz des Kindes seine Geschichte unter falschem Namen erzählt, an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) geschrieben, weil die Mutter trotz Beistandschaft nicht zur Übergabe des Kindes auftauchte. Er hatte eine Anwältin eingeschaltet, Gutachten abgewartet und das Urteil. Ein Jahr sind für Erwachsene 365 schmerzvolle Tage, für kleine Kinder ist es eine Ewigkeit.
An diesem Maitag 2019 taute das Mädchen beim Kartenspiel im Besuchstreff zwar allmählich auf. Doch als der Vater die Tochter zum Auto brachte, um ins Wochenende zu fahren, das er sich vor Kantonsgericht erstritten hatte, wehrte sie sich mit Händen und Füssen gegen das Anschnallen im Kindersitz. Er fuhr los und brachte das Kind, das nicht aufhören wollte, nach der Mama zu weinen, wieder zur Beiständin zurück, noch bevor er vom Parkplatz in die Strasse eingebogen war. Vor Gericht hatte er gewonnen, in der Realität längst verloren.
Die Geschichten, die hier erzählt werden, halten nur die halbe Wahrheit fest. Doch den 20 350 Kindern zuliebe, die 2022 in der Schweiz unter Schutzmassnahmen gestellt wurden, müssen sie erzählt werden. An einer Tatsache nämlich vermag auch die fehlende Sicht des anderen Elternteils, in diesem Fall der Mutter, nicht zu rütteln: Die grössten Opfer sind immer die Kleinsten. Der Kampf, den zerrüttete Paare auf ihren Schultern austragen, wird immer härter.
Wurden 2015, im Jahr nach der Einführung des gemeinsamen Sorgerechts, noch 11 413 Beistandschaften angeordnet, so zählte man 2022 bereits 17 769 und damit fast ein Drittel mehr. Inzwischen gibt es pro Jahr gar mehr angeordnete Vermittlungen in Kontaktstreitigkeiten zwischen den Eltern als Scheidungen. Nicht nur, weil sie auch für unverheiratete Eltern angeordnet werden, sondern weil Beistandspersonen oft jahrelang in bestehenden, aber zerrütteten Familien vermitteln. Viel zu oft ohne Erfolg.
Die Aufgabe, den Konflikt zwischen Eltern zu entschärfen, die sich bis aufs Blut bekämpfen, bringt eine ganze Behörde ans Ende ihres Lateins: «Weil die Kesb und Beistandspersonen diese Elternkonflikte nicht oder nur bedingt lösen können, sind neue Konzepte gefragt», hielt die Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (Kokes) in ihrem Jahresbericht Ende September ernüchtert fest. «Hochstrittige Trennungen und Scheidungen verursachen fast die Hälfte aller Kindesschutzmassnahmen in der Schweiz», konkretisiert Diana Wider, Generalsekretärin der Kokes. «Sie binden einen grossen Teil der Ressourcen, sorgen für Frustpotenzial bei den Beiständen, kosten auch den Steuerzahler viel Geld und können für das Kind oft wenig bis nichts ausrichten.»
Das klingt wie eine Kapitulation der Behörde, der in familiären Dramen oft der schwarze Peter zugeschoben wird. Eine «fatale Nähe» («Tages-Anzeiger») zu den Gerichten wird der Kesb von Medien und Betroffenen gern vorgeworfen, die dazu führe, dass ein Elternteil, meist der Vater, aus dem Leben der Kinder ausgesperrt werde. Das mag in kleinen Kantonen vereinzelt zutreffen, doch die Zuspitzung des elterlichen Kampfes um das Kind ist damit nicht erklärt. Die Gründe dafür sind komplex und nur mit einem Blick auf die gesellschaftlichen Entwicklungen und die damit verbundenen Änderungen im Familienrecht zu verstehen.
Verschiebung der Kampfzone
Christoph Häfeli ist der Doyen des Kindesschutzes. Er hat miterlebt, wie die Mütter sich von Heim und Herd emanzipierten und die Väter zu neuen Vätern wurden. Der Jurist und Sozialarbeiter war Mitglied in diversen Expertengruppen des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, hat diverse Fachbücher zum Kinder- und Erwachsenenschutzrecht verfasst und beobachtet das Scheidungsverhalten seit 50 Jahren. «Es gibt heute mehr Eltern, die sich friedlich trennen», sagt er, «weil eine Scheidung kein Stigma mehr ist und die Mehrheit der Frauen ebenfalls Geld verdienen. Aber die hochstrittigen Paare, sie machen etwa 10 Prozent aller Trennungen aus, bekämpfen einander erbitterter als je zuvor.»
Einer der Gründe für die Eskalation sieht Häfeli im gemeinsamen Sorgerecht, das in der Schweiz 2014 als Regel eingeführt worden ist und auch unverheirateten Eltern zusteht. Für die allermeisten Paare sei diese Änderung richtig und wichtig gewesen. Zerstrittenen Paaren aber habe die geteilte Sorge als Regel und die von Gerichten grosszügig angeordnete alternierende Obhut viele neue Konfliktfelder eröffnet: Jetzt, da sie alles gemeinsam entscheiden müssen, kann jedes aufgeschlagene Knie, jedes Computerspiel, jedes Schulproblem den Streit anheizen. «Der Staat», sagt er, «kann diese privaten Probleme nicht lösen. Auch nicht, indem er autoritativ ein Urteil fällt. Meist steckt das Kind dann schon in einem Loyalitätskonflikt.»
Fakt ist: Jedes Verfahren vor Gericht schmälert die Chancen des Kindes auf den regelmässigen Kontakt zum Elternteil, bei dem es nicht wohnt. Das hat mittlerweile auch die Politik eingesehen. Nach den Revisionen zur Modernisierung des materiellen Familienrechts fordern verschiedene parlamentarische Vorstösse eine Verbesserung der Verfahren, um das Leiden der Kinder zu mildern. Nun hat das Bundesamt für Justiz (BJ) auf den 27. November eine interdisziplinäre Tagung mit Fachleuten aus Praxis, Forschung und Theorie einberufen, um über Best Practices im Umgang mit familiären Konflikten zu diskutieren. Ausserdem hat es ein Pilotprojekt genehmigt, aber dazu später mehr.
Wenn Papa schlechtgeredet wird
Es braucht nicht viel, um ein Kind dem Vater zu entfremden. Die Anordnung eines Gutachtens reicht, um den Kontakt monatelang zu unterbinden. Ein unglückliches Gesicht der Mama reicht, um dem Kind die Vorfreude auf den Besuch bei Papa zu rauben. Was das bedeuten kann, hat Patrick Widmer buchstäblich am eigenen Leib erfahren: «Ich bringe die kleinen Fäuste mit den rosa Nägeln, die im Auto auf mich eintrommeln, nicht mehr aus dem Kopf», sagt er. Vier Jahre nachdem er seine Tochter zuletzt gesehen hatte, sitzt er im Büro seiner Wohnung. Es ist mit bunten Ballonen tapeziert. Nach jahrelangem Kampf verzichtet er seither auf das vor Kantonsgericht erstrittene Recht, seine Tochter, für die er monatlich 2100 Franken Alimente zahlt, jedes zweite Wochenende zu sehen.
«Ich konnte es ihr und mir einfach nicht antun.» Der 51-jährige Ingenieur will zwar anonym bleiben, gewährt aber Einsicht in sämtliche Akten. Das ganze Elend eines elterlichen Kampfes um das gemeinsame Kind, ordentlich gelocht und abgelegt in drei Bundesordnern: die Vaterschaftsanerkennung. Eine bei der Kesb hinterlegte Unterhaltsvereinbarung der Eltern nach der Trennung 2017, gemäss der die Tochter zwei Tage die Woche bei ihm wohnen soll. Ein Gutachten im Rahmen einer Kindesschutzmassnahme, das der Mutter «Bindungsintoleranz» attestiert und damit festhält, dass sie den Kontakt zum Vater aktiv erschwert. Das letzte und damit gültige Urteil von 2019. Seine Tochter wird bald zehn, wie sie ihr Haar heute trägt, weiss Widmer nicht.
Eigentlich wollte das Parlament, als es das gemeinsame Sorgerecht zum Regelfall machte und das Unterhaltsrecht revidierte, genau das Gegenteil erreichen, nämlich die gemeinsame Elternschaft fördern. Auch ein Bundesgerichtsurteil von 2020 priorisiert die alternierende Obhut. Doch die Realität hinkt dem Gesetz hinterher. Noch gibt es viele Mütter, die nur in Kleinpensen tätig sind, um den Nachwuchs zu betreuen, während die Väter arbeiten. Noch gibt es manch einen Richter, der noch immer glaubt, dass in der Familie die Mutter zählt und der Vater zahlt. In neun von zehn Fällen sind es die Väter, die aus der Familie gedrängt werden. Das aber lassen sie sich immer weniger gefallen.
Manch ein Richter glaubt noch immer, dass in der Familie die Mutter zählt und der Vater zahlt.
«Die Gesellschaft hat nach den neuen Vätern gerufen, jetzt sind sie da und fordern ihre Rechte ein», sagt Oliver Hunziker. Der Informatiker und Aargauer Politiker berät seit zwanzig Jahren Eltern in Trennung. Am letzten stürmischen Donnerstagabend im Oktober sitzt er mit sechs Männern im Kreis im ersten Stock des Familienzentrums beim Bahnhof in Baden. Das Mobiliar im Raum stammt aus der Ikea, in der Luft hängt eine schwer verdaubare Mischung aus Hoffnung, Hilflosigkeit und Hass, das Vokabular erinnert an die Berichterstattung aus einem Kriegsgebiet. Von Angriff ist die Rede, Bomben platzen, Verteidigungsschläge werden geplant, und einmal fällt auch das Totschlagargument Missbrauch.
Drei der anwesenden Väter sehen ihre Kinder nicht mehr, zwei kämpfen um die alternierende Obhut, und einer möchte seine Ex-Frau dazu bringen, wieder zu arbeiten. Hunziker interpretiert Anwaltsschreiben, ermutigt einen Anwesenden, bei der Schulleitung des Sohnes sein Recht auf Information einzufordern. Vorab aber rückt er immer wieder das Interesse der Kinder ins Zentrum, wenn die Männer in den Anklagemodus geraten.
Der Weg ins Unglück ist immer gleich
Nachdem er sich von den Vätern verabschiedet hat, bestätigt Oliver Hunziker, dass auf beiden Seiten mit immer «härterem Geschütz» aufgefahren werde: Manch eine Mutter nutze aus, dass die Kesb beim kleinsten Verdacht auf Gewalt oder Missbrauch einschreiten müsse und die Beschuldigten ihre Kinder für Monate nicht mehr zu Gesicht bekommen. Manch ein Vater wiederum unterstelle seiner Ex-Partnerin Tablettenkonsum oder eine Persönlichkeitsstörung. Am längeren Hebel sitzt fast immer der Elternteil, bei dem die Kinder mehr Zeit verbringen. Hunzikers Beobachtung wird von vielen Fachleuten bestätigt, die für diese Recherche kontaktiert worden sind.
«Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich, jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise.» Mit diesen Worten eröffnet Lew Tolstoi seinen Jahrhundertroman «Anna Karenina». Hätte der russische Schriftsteller die Geschichte über eine zerrüttete Ehe im neuen Jahrtausend geschrieben, hätte er anfügen können: Aber der Weg ins Unglück ist immer derselbe. Egal ob Mütter oder Väter ihre Geschichte erzählen, egal welche Bildung sie genossen haben, aus welcher sozialen Schicht sie kommen: Hochstrittige Trennungskonflikte gehorchen gemäss internationalen Studien stets dem gleichen Muster. Die Eltern bleiben in der seelisch-emotionalen Zerrüttung gefangen. Der Paarkonflikt absorbiert sie so sehr, dass sie den Nachwuchs aus dem Blick verlieren. Involvierte Dritte, etwa Kesb-Beistände, werden von beiden Seiten manipuliert. Der Konflikt weitet sich auf Grosseltern und das Umfeld aus, gelangt ans Gericht, das sich wiederum an Gutachten hält, um die schwierige Frage zu beantworten, ob Vater oder Mutter eher für das Wohl des Kindes sorgen. Am Schluss entscheiden die besten Anwälte.
Die unschuldigen Kinder aber sitzen im Auge des Sturms, werden hin- und hergerissen. Dem Loyalitätskonflikt können sie nur entkommen, wenn sie sich von einem Elternteil abspalten.
Auch das Familiendrama, das Andrea von Arx schildert, gehorcht diesem Muster. Die 48-jährige Psychiatriepflegefachfrau hat ihre vier Kinder vor gut zwei Jahren zum letzten Mal gesprochen. Gesehen hat sie sie vor kurzem noch einmal in der Kirche anlässlich der Konfirmation der Tochter, zu der sie nicht eingeladen war. Seit der Trennung 2017 setzt sie alles daran, den Kontakt nicht ganz zu verlieren. Die schriftlichen Spuren dieses Kampfes hat sie zum Treffen in Bern mitgebracht: ein Polizeibericht, der massive Drohungen des Vaters via Textnachrichten dokumentiert, ein Schreiben des Kesb-Beistandes, das festhält, dass der Ex selber Scheidungsopfer und ohne Vater aufgewachsen ist und wenig Kontakttoleranz zeigt, Anwaltsschreiben, Gutachten, Vorladungen. Das Übliche.
Wer zuerst auszieht, macht sich verwundbar
Die seelischen Spuren sind nicht dokumentiert. Sie holen Andrea von Arx im ganz profanen Alltag ein. Für ihre Geschichte steht sie mit vollem Namen ein. Weil die Kinder anders heissen. Und sie, wie sie sagt, «alles verloren hat, was es zu verlieren gibt». Einmal, nicht lange nachdem sie 2017 aus dem Einfamilienhaus irgendwo im Emmental ausgezogen war, füllte sie in der Migros den Einkaufswagen. Drei Liter Milch, 12 Joghurts, Butter, Brot. Wie ferngesteuert führte die mütterliche Haushaltsliste im Kopf sie durch die Regale. Erst als sie beim Gestell mit den Müesliriegeln die Lieblingssorte der Tochter nicht finden konnte, schaltete der Autopilot sich aus, brach die neue Realität in ihr Bewusstsein ein, und die Mutter von vier Kindern im Alter zwischen acht und sechzehn verliess fluchtartig den Laden.
15 Jahre lang war von Arx gar nicht oder nur einen Tag pro Woche berufstätig, um die Kinder grosszuziehen. Ihr Ehemann bekleidet eine hohe Stellung in einem Schweizer Unternehmen. Dass seine Frau sich weiterbildete, als die Kinder grösser wurden, sah er nicht gern, immer öfter eskalierte der Streit. Er wollte keine Trennung, drohte seiner Frau damit, «ihr das Leben zu nehmen, wenn keiner mehr hinschaut». Dass von Arx 2017 aus dem gemeinsamen Haus auszog, wurde ihr zum Verhängnis. Das Gericht entschied, wie es fast immer entscheidet, nämlich dass die Kinder im gewohnten Umfeld bleiben.
Das Wort «Erinnerungskontakt» dürfte es im Vokabular einer zivilisierten Gesellschaft nicht geben.
Die beiden volljährigen Söhne wollen heute nichts mehr von der Mutter wissen. Die beiden jüngeren Töchter verpflichtet die Kesb zu einem jährlichen Erziehungsaufsichtstermin, wo sie nach ihren Kontaktwünschen zur Mutter befragt werden. «Erinnerungskontakte», nennen Behörden den letzten verzweifelten Versuch, den Elternteil, der den Kindern entfremdet worden ist, nicht zu einem Namen verkommen zu lassen, der bloss für Vorwürfe und Vorurteile steht.
Auch die Geschichte von Andrea von Arx ist unvollständig. Doch eines vermöchte die Version ihres Ex-Mannes nicht zu ändern: Das Wort «Erinnerungskontakt» dürfte es im Vokabular einer zivilisierten Gesellschaft nicht geben. Eine Entfremdung nämlich ist nicht nur das bittere Ende eines Rosenkrieges. Sie ist immer auch der Beginn eines oft lebenslangen Kampfes, der im Inneren des Kindes tobt.
Mediationszwang statt Gerichtsurteil
Mit einer frühen Intervention könnte man solchen Entfremdungen entgegenwirken. Das haben verschiedene ausländische Modelle gezeigt, etwa die Cochemer Praxis in Deutschland. Sie ist unter anderen Vorbild des Pilotprojekts ZFIT (Zentrum für Familien in Trennung) in Bern und eine der Best Practices, über die an der Konferenz des Bundesamtes für Justiz diskutiert wird. Weil es Gerichten in der Schweiz nicht erlaubt ist, zerstrittene Paare vor der Scheidung zu einer Mediation zu verpflichten, hat der Kanton Bern in Absprache mit dem Bundesamt für Justiz für den Pilotversuch erstmals eine Sondergenehmigung der Zivilprozessordnung zur Anwendung gebracht. Anfang September ist das Pilotprojekt gestartet.
Im grossen, freundlichen Raum eines Berner Patrizierhauses sitzt Philippe Jampen an der Spitze des Dreiecks, das er aus drei Sesseln im Raum gebildet hat. Eine Anordnung, die dem Sozialarbeiter ermöglicht, die beiden zerstrittenen Elternteile stets im Blick zu haben. Für die Sitzung holt er sie jeweils einzeln in der Lobby ab. Der Beratungsablauf sei bis ins kleinste Detail durchgeplant, erklärt Jampen, er werde wissenschaftlich begleitet und folge klaren Regeln: Die Eltern werden nicht mit Namen, sondern konsequent als Vater und Mutter von Julia oder Leon angesprochen, sie reden nicht miteinander, sondern bringen ihre Anliegen via Berater ein.
Jedes Ansetzen zum Lamento über den Ex-Partner wird sofort unterbrochen. Jede Respektlosigkeit sanktioniert. Für die Dauer der Beratung werden keine Klagen eingereicht, keine Gutachten angeordnet. Ziel ist es, dass die Eltern sich in sechs bis acht Terminen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zum Wohl ihres Kindes einigen. Dieser wird schriftlich festgehalten, von beiden Elternteilen unterschrieben und der Kesb oder bei verheirateten dem Gericht vorgelegt.
«Es ist erstaunlich, wie sich die Perspektive der Eltern ändert, wenn sie gezwungen werden zuzuhören, wenn der gehasste Ex plötzlich die Tochter lobt», sagt Philippe Jampen.«Ich habe schon in den ersten beiden Monaten erlebt, dass der angeordnete Einigungsdruck Eltern wieder ins Gespräch bringt.» Man kann, nach all den leidvollen Geschichten, nicht anders, als sich von Jampens Enthusiasmus anstecken zu lassen. Der kleinste gemeinsame Nenner der Eltern bedeutet in der Mengenlehre des Kindes ein grosses Glück: Es darf Mama und Papa lieben.