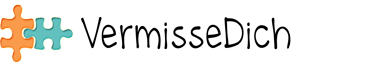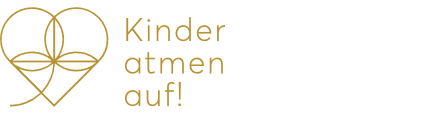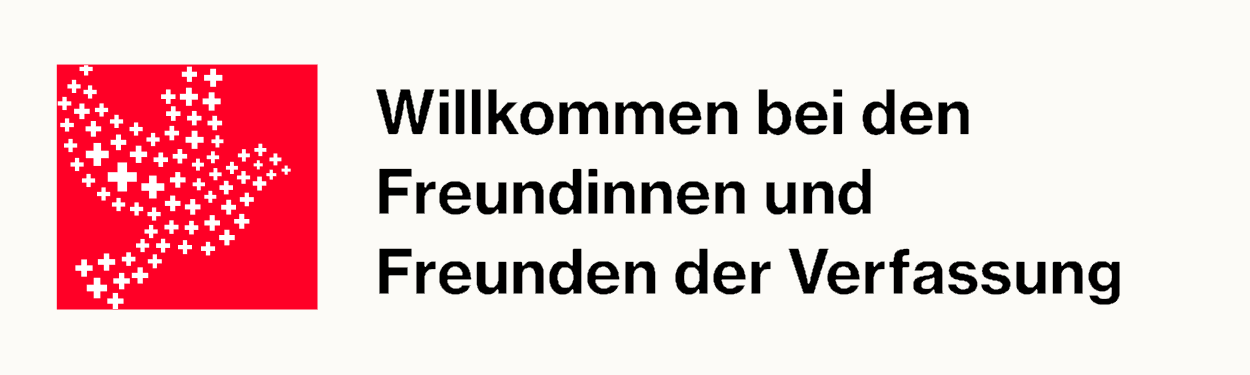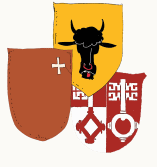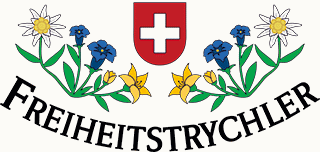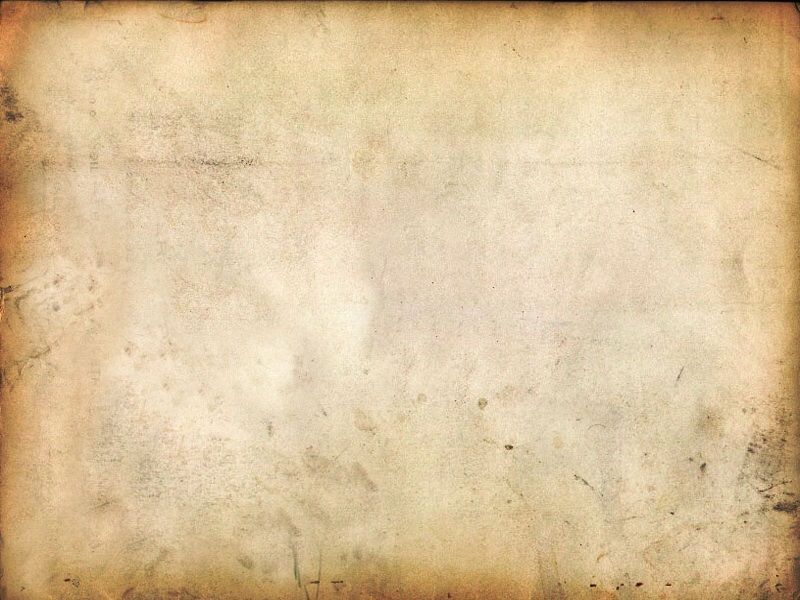Schweizweit werden die neuen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden mit Argusaugen beobachtet. Auch im Kanton Bern sorgt erneut ein Fall für Kritik – das Obergericht hat einen Entscheid im Seeland gerügt.
Diesen Moment vergisst sie wohl nicht so schnell wieder: Um 11.45 Uhr bekommt sie einen Anruf an den Arbeitsplatz, ihre Tochter sei nicht mehr zu Hause, sondern in der Obhut des Vaters. Das war für die Mutter der erste Kontakt mit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb).
Seit das Kind zweieinhalb Jahre alt war, sorgte die Frau als alleinerziehende Mutter für die mittlerweile zwölf Jahre alte Tochter. «Wir hatten einen guten Draht», sagt die Mutter über die Beziehung zu ihrem Kind. Sie verschweigt aber auch nicht, dass es Probleme gab. In den letzten Monaten hätten sie nur wenig Zeit füreineinander gehabt. Die Mutter nahm zu ihrem Arbeitspensum eine Ausbildung in Angriff, und auch die Tochter hatte offenbar einen zunehmend vollen Terminkalender. Im Austausch mit einer Lehrerin erfuhr die Mutter zudem, dass die Tochter ihre Unterschrift fälschte, indem sie Schularbeiten selber unterschrieb, statt sie der Mutter vorzulegen. In diesem Zusammenhang habe sie ihre Tochter einmal geohrfeigt, sagt die Frau.
Auch mehr als fünf Monate nachdem die Behörden der Frau die Tochter weggenommen haben, ringt sie um Fassung. Ihre Stimme zittert, wenn sie darüber spricht, was man ihr alles vorwirft.
Superprovisorische Massnahmen
Bei der örtlichen Jugendfachstelle soll das Mädchen von «wiederkehrenden Gewaltattacken» gesprochen haben. Auch eine Lehrerin ist von einer Misshandlung des Kindes ausgegangen, wie einem Schreiben des Anwalts des Vaters zu entnehmen ist. Dieser hatte nicht nur eine Gefährdungsmeldung an die Kesb gemacht, sondern via Anwalt ein Gesuch um «superprovisorische Massnahmen» gestellt. Mit der Kindsmutter stritt sich der Vater mehrmals und zum Teil auch gerichtlich über die Besuchsrechtsregelung. «Innert fünf Tagen hat die Kesb die verlangten superprovisorischen Massnahmen durchgewinkt», sagt die Mutter. So lange hat es von der eingegangenen Gefährdungsmeldung bis zur Umplatzierung der Tochter gedauert. Die Mutter wurde zwar von der Kesb angehört, aber erst nachdem bereits alles entschieden und vollzogen war.
«Vom Hörensagen»
Seit die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden Anfang 2013 die kommunalen Vormundschaftsbehörden ablösten, sehen sie sich mit Kritik konfrontiert. Anfangsschwierigkeiten stellten die Behörden nicht in Abrede, eine umfassende Bilanz ist noch ausstehend. Im vorliegenden Fall ist aber klar, dass die zuständige Kesb nicht alles richtig gemacht hat, ein Urteil des Obergerichts stellt kein besonders gutes Zeugnis aus.
Beanstandet wird in der Beschwerdeantwort, dass die Kesb aufgrund von unzureichenden Grundlagen einen definitiven Entscheid über den Obhutswechsel gefällt habe. Dabei stütze sich die Behörde auch auf Angaben von Personen ab, die diese nur vom Hörensagen kennten. Da unklar sei, wie massiv die Übergriffe der Mutter seien, sei es nachvollziehbar, dass die Kesb sofort habe handeln müssen. «Aber auch ein Obhutsentzug kann eine Gefährdung des Kindeswohls darstellen», schreibt das Obergericht. Gar nicht einverstanden ist die Beschwerdeinstanz damit, dass der Mutter der Kontakt ganz verboten wurde. «Ich sah mein Kind seither nie mehr», sagt die Mutter.
Sie sei von der Kesb «sistiert» worden. Das Obergericht verlangt deshalb von der Kesb, dass der persönliche Verkehr zwischen Tochter und Mutter umgehend geregelt werde. Obwohl seit dem Entscheid mehrere Wochen vergangen sind, sei bisher nichts passiert, sagt die Frau. In der Frage, wer definitiv die Obhut über das Kind haben soll, verlangt das Obergericht weitere Abklärungen. In einer Stellungnahme ans Obergericht hatte sich die Kesb auf den Standpunkt gestellt, weitere Abklärungen seien nicht getroffen worden, weil sie sich davon kein anderes Resultat versprochen habe.
Zum konkreten Fall nimmt Yves Abelin, Präsident der Kesb Seeland, keine Stellung. Generell hält er aber fest: Bei einer neuen Behörde brauche es Anfechtungen von Entscheiden, damit sich die Praxis herauskristallisieren könne. Bei der Kesb Seeland seien etliche Entscheide angefochten worden, einige habe das Obergericht anders beurteilt. Die Kesb seien schweizweit in der Kritik. «Im Kanton Bern sind wir aber auf gutem Weg», sagt Abelin. Die Kesb Seeland habe ihre Pendenzen abgebaut, einzig die Zweisprachigkeit sei eine besondere Herausforderung.
Grossrat ortet Missstände
Auf nationaler Ebene hat der Bundesrat kürzlich zwei parlamentarische Vorstösse zur Annahme empfohlen, die verlangen, dass Qualität und Kosten des Wechsels überprüft werden. Auf kantonaler Ebene will der grünliberale Grossrat Michel Rudin (Lyss) aktiv werden und eine Interpellation einreichen. Er habe im Raum Seeland von mehreren Missstandsfällen Kenntnis und wolle deshalb von der Regierung wissen, was zur Verbesserung der Kesb gemacht werde. Ihm schweben vordefinierte Verfahrensschritte und ein Benchmark vor, damit im Kanton eine einheitliche Qualität erreicht werde. (Der Bund)