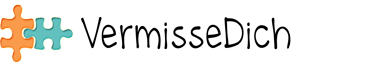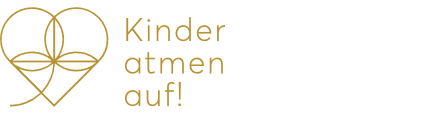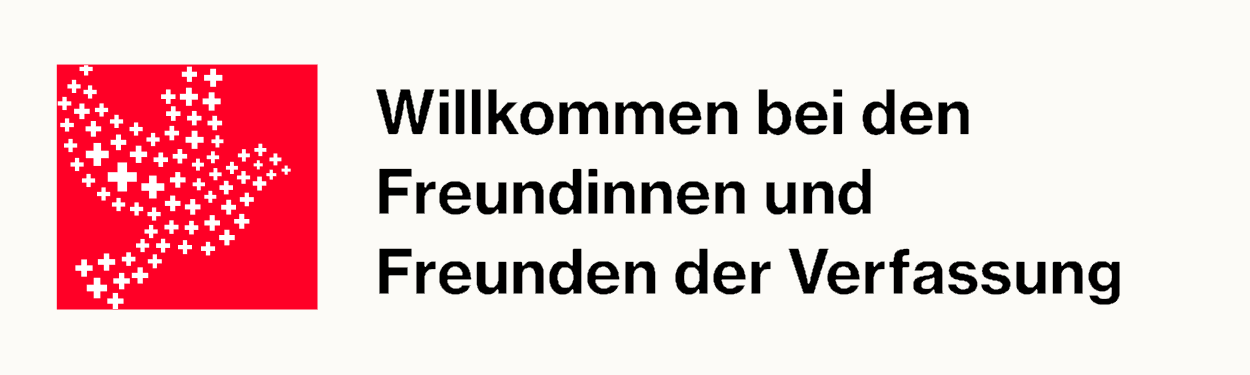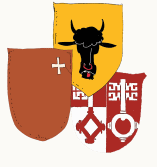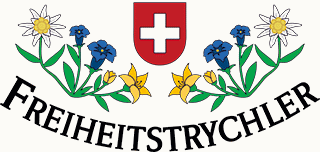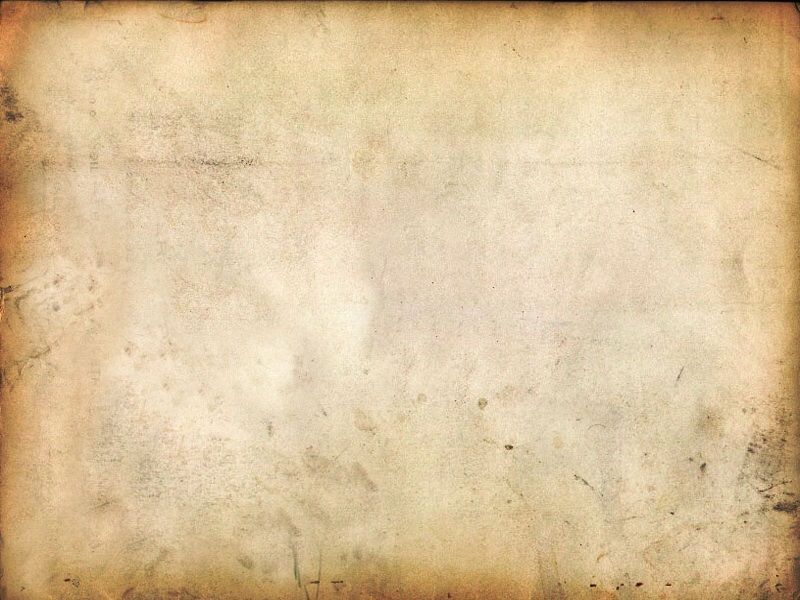Eine Liebe geht zu Ende, der Streit um den Sohn beginnt. Ein Fall, wie er zu Tausenden vor den Familiengerichten landet. Anschuldigungen stehen im Raum, Experten sagen aus. Schließlich verliert ein Junge seine Mutter. Ist das gutes Recht?
An einem Wintermorgen dieses Jahres steigt Tanja Krüger* die Stufen zu einem bayerischen Oberlandesgericht hinauf. An ihre Brust hat sie einen Aktenordner gedrückt, wie einen Schild. Als könnte Papier sie schützen vor dem, was auf sie zukommt. Vor den Fragen des Richters. Den verbalen Angriffen der Anwälte. Vor der Gegenseite. In ein paar Minuten wird die Verhandlung beginnen. Es ist nicht ihre erste, Tanja Krüger kämpft schon lange. Obwohl sie weiß, dass sie am Ende verlieren wird – so oder so.
Tanja Krüger kämpft um das Kind, das sie vor acht Jahren geboren hat und von dem sie heute nicht einmal genau weiß, wie es aussieht. Monate ist es her, dass sie zuletzt ein Foto ihres Sohnes zu Gesicht bekam, drei Jahre, dass sie ihn das letzte Mal bei sich zu Hause hatte. Sie hat das Sorgerecht verloren. Ein deutsches Gericht wollte es so.
Der Fall von Tanja Krüger ist einer von Zigtausenden Sorgerechtsfällen, die jedes Jahr verhandelt werden. In ihm offenbart sich, was an vielen deutschen Familiengerichten immer noch grundsätzlich falsch läuft. Tanja Krügers Geschichte zeigt, dass vermeintliche Fachleute nicht immer Fachwissen haben. Dass Anwälte mitunter als Kriegstreiber agieren. Sie zeigt, wie ein ganzes System vorgibt, zum Wohle des Kindes zu handeln, und dem Kind dabei den größtmöglichen Schaden zufügt. Sie zeigt auch, wie schnell es passieren kann, dass einer Mutter oder einem Vater das eigene Kind Monate, sogar Jahre vorenthalten wird.
Tanja Krüger ist weder drogensüchtig noch geisteskrank. Sie hat, so sagt es das Jugendamt, ihren Sohn weder physisch noch psychisch missbraucht. Welchen Grund gibt es dann, sie aus dem Leben ihres Kindes auszuschließen? Kann und darf das sein? Tanja Krüger schüttelt den Kopf. “Hätte mir das jemand vor fünf Jahren erzählt, nein, ich hätte ihm nicht geglaubt.” Manchmal glaubt sie es heute noch nicht.
Tanja Krüger, eine Frau Mitte vierzig, wohnt in einem Einfamilienhaus ohne eine Familie. Sie sitzt neben dem Kamin, vor dem sie früher oft mit ihrem Sohn saß und Kakao trank. Im ersten Stock das Kinderzimmer, immer noch mit den Holzbauklötzen auf dem Fußboden. Der Plüschteddy auf einem Kinderstuhl. Es sieht aus, als lebe hier ein kleiner Junge. Es sieht aus, als sei der Sohn nur kurz zum Spielen draußen.
Alles begann am 8. März 2012, einem Donnerstag. Wie jeden Wochentag holt Tanja Krüger ihren damals fünfjährigen Sohn Tim* vom Kindergarten ab, kocht ihm Mittagessen. Später malen sie zusammen Mandalas, irgendwann geht Tim raus, um im Garten auf seinem grünen Plastiktraktor herumzufahren. Es dämmert bereits, als Tims Vater kommt, um ihn abzuholen. Der Junge nimmt seine Tasche, drückt seine Mutter kurz. Am Tor winkt er. “Bis Montag, Mama.” Übers Wochenende wird Tim beim Vater bleiben. Es ist ein Tag wie viele andere in den vergangenen Monaten, seit Tanja Krüger und ihr Lebensgefährte sich getrennt haben. Und doch ist es ein besonderer Tag, nur weiß Tanja Krüger das noch nicht: der letzte gemeinsame Tag mit ihrem Kind.
Zehn Jahre lang waren Tanja Krüger und Tims Vater ein Paar. Er ein sehr wohlhabender Geschäftsmann, sie eine Akademikerin. Sie verliebte sich in dem Moment, als sie ihn sah, sagt sie. Ganz schnell sei es gegangen. Schnell zog das Paar zusammen, schnell gab Tanja Krüger ihren Job auf und fing an, in seinem Unternehmen zu arbeiten. Tag und Nacht waren sie zusammen. Alles schien perfekt. Die ganz große Liebe. Nur gehalten hat sie nicht.
Gekriselt hatte es zwischen den beiden schon, bevor Tanja Krüger mit Tim schwanger wurde. Mit der Geburt des Kindes schien alles wieder gut zu sein. Der Vater kümmerte sich rührend um Tim, und Tanja Krüger war so stolz. Er war ein guter Vater, sagt sie noch heute.
Trotz aller Freude über das gemeinsame Kind, die Diskrepanz zwischen Mutter und Vater wuchs wieder. Sie stritten, über Kleinigkeiten und Grundsätzliches und mit jedem Mal lauter. Das Kind immer dazwischen. Schließlich zog sie aus, kehrte wieder zu ihm zurück. Ein ewiges Hin und Her. Ende 2009 trennten sie sich endgültig.
Es war nicht das erste Mal, dass Tanja Krügers Traum von einer heilen Familie platzte. Als sie Tims Vater traf, hatte sie bereits einen Sohn im Grundschulalter – und eine gescheiterte Ehe hinter sich. Sie wusste aus Erfahrung, dass ein Kind beide Elternteile braucht. Bei ihrem Erstgeborenen teilten sie und ihr Exmann die Zeit mit dem Jungen genau auf. Als er aufs Gymnasium kam, blieb er unter der Woche beim Vater, weil der näher an der Schule und am Sportverein wohnte. Nie stritten sich die Eltern vor Gericht. “Wir haben uns vernünftig geeinigt”, sagt Krügers Exmann heute. Nie habe sie ihm den Sohn vorenthalten.
Mit Tims Vater lief es anders. Ein paar Wochen nach der Trennung schon die ersten Streitigkeiten, bei wem der Junge leben sollte. Schon damals wollte der Vater das Aufenthaltsbestimmungsrecht für den gemeinsamen Sohn. Schon damals standen die beiden vor Gericht. Doch damals ging es noch glimpflich aus. Der Richter am Amtsgericht entschied klug. Mutter und Vater bekamen das gemeinsame Sorgerecht, und eine Elternvereinbarung regelte genau, wann das Kind bei wem zu sein hatte. Tim sollte, so die Vereinbarung, bei der Mutter wohnen. Dienstag, Donnerstag und jedes zweite Wochenende Besuch beim Vater. Die Ferien möge man sich aufteilen, an Weihnachten sich abwechseln. Außerdem sollte Tanja Krüger sich eine Bleibe suchen, die nicht weiter als 75 Kilometer entfernt vom Haus des Kindsvaters lag. Die Vereinbarung klingt gut, nur eingehalten wird sie nie. Das Haus, in das Tanja Krüger mit ihrem Sohn ziehen will, liegt zwar nicht weit vom Wohnhaus des Vaters, ist aber eine halbe Ruine. Die Eltern beschließen daher: Solange das Haus renoviert wird, soll Tim nur die Nachmittage bei seiner Mutter verbringen, schlafen wird er bei seinem Vater und dessen neuer Lebensgefährtin. So geschieht es.
Man kann nicht sagen, dass das Verhältnis herzlich war, sagt Tanja Krüger heute, aber es funktionierte. Alle funktionierten. Des Kindes wegen. Zumindest scheint es so. Bis Tanja Krüger endlich die Elternvereinbarung durchsetzen will. Das Haus ist fertig, nun soll Tim die Hälfte der Zeit bei ihr verbringen.
Am Montag, dem 12. März 2012, erinnert sich Tanja Krüger, schreibt Tims Vater per SMS, Tim sei krank und bleibe deshalb bei ihm. Am Dienstag muss Tanja Krüger wie immer länger arbeiten. Tim bleibt beim Vater. Am Mittwoch ruft er an. “Er sagte, dass er Tim nicht mehr zu mir bringen werde, weil laut Jugendamt eine Anzeige wegen Kindeswohlgefährdung gegen mich vorliege. Ich dachte: Das kann doch wohl nicht sein, ich habe doch nichts getan!”, sagt Tanja Krüger. Doch tatsächlich liegt in ihrem Briefkasten ein Brief vom Jugendamt. Darin steht, es sei eine Anzeige wegen Kindeswohlgefährdung eingegangen. Mehr nicht.
Erst viel später erfährt Tanja Krüger, was genau passierte: Jemand hat beim Jugendamt angerufen. Die Mitarbeiterin notierte: “Nachbarschaft, anonym. Circa 4 ½. Junge. Rasenmäherverletzung. Sei meist ohne Aufsicht. Der Vater sei eher zugänglich!” Außerdem ging ein Brief beim Jugendamt ein, auf Schreibmaschine geschrieben, ebenfalls anonym. Darin steht: “Mit dem Kind wird nicht gesprochen, nur geschrien, und es gibt keine liebevolle Geste von der Mutter. Im letzten Sommer schob der Junge ohne Aufsicht einen Rasenmäher. Manchmal sitzt der Junge, egal ob es regnet oder schneit, vor dem Haus und wartet auf seinen Vater. Das Kind zeigt deutlich, dass es sich bei seiner Mutter nicht wohlfühlt. Bitte gemäß § 8a überprüfen.” Das bedeutet: Kindeswohlgefährdung.
Tanja Krüger erscheinen die Vorwürfe absurd. Sie ist sich sicher: Alles wird sich schnell aufklären.
Sie hat die Nachbarn von nebenan in Verdacht. Ein älteres Ehepaar, mit dem sie immer wieder im Streit liegt. Mal geht es um Hecken, die zu viel oder zu wenig geschnitten wurden. Mal um Efeu, der über die Mauer ragt, um Laub, das im Garten verbrannt wird. Es gibt wenig freundliche Worte zwischen ihnen.
Ein paar Tage nach der Anzeige gegen Tanja Krüger kommt die zuständige Sachbearbeiterin vom Jugendamt zu einem Hausbesuch. So ist das üblich bei Anzeigen wegen Kindeswohlgefährdung. Sie stellt Fragen zu dem angeblichen Unfall mit dem Rasenmäher. Sie besichtigt das Haus und den Garten. Auch mit mehreren Nachbarn spricht sie.
Ob die Anzeige tatsächlich aus der Nachbarschaft kam oder doch von jemand anderem, ist bis heute ungewiss. Für einen Rasenmäherunfall gibt es keinerlei Beleg. Es existiert auch kein ärztliches Attest, dass Tim eine Verletzung habe. Die Dame vom Jugendamt findet keinen Hinweis auf eine Verletzung der Aufsichtspflicht.
Trotzdem wird kurz darauf, am 27. März 2012, vor dem Amtsgericht das Sorgerecht neu verhandelt. Im Eilverfahren. Auch, weil Tims Vater die Angst äußert, dass Tanja Krüger mit Tim wegziehen könnte – obwohl ihr Haus endlich fertig renoviert ist. Tanja Krüger erinnert sich noch genau an das Verfahren, jenen verhängnisvollen Tag, der alles verändern sollte. Sie weiß noch, wie sie im Gerichtsflur ihren Sohn sieht. Wie er auf dem Schoß der neuen Lebensgefährtin des Vaters sitzt. Als sie auf ihn zugeht, dreht er sich weg. Als sie ihn umarmen will, verweigert er sich. “Ich verstand Tims Verhalten nicht. Ich verstand nicht, wieso er so ablehnend war.” Dann die Gerichtsverhandlung: “Ein einziger Albtraum”, sagt sie.
Die Rechtsanwältin des Vaters hat schriftliche Aussagen seiner Hausangestellten bei Gericht eingereicht. “Nie habe ich beobachtet, dass Frau Krüger ihren Sohn geküsst hat”, schreibt die eine Angestellte über die Zeit, als Frau Krüger noch mit im Haushalt lebte. “Frau Krügers extreme Schreianfälle durchhallten oft das ganze Haus”, schreibt die andere. Schon vor der ersten Verhandlung hat eine Hausangestellte Ähnliches geschrieben, sich dann aber im Nachhinein bei Tanja Krüger per Brief entschuldigt. Die neue Lebensgefährtin schreibt in ihrer Aussage über Tanja Krüger, diese schenke ihrem Sohn keinerlei Beachtung. Sie lasse Tim im Winter bei minus 12 Grad Celsius stundenlang im Freien spielen. Die Mutter sei mit ihrem Sohn schon immer überfordert gewesen. All das will die Lebensgefährtin beobachtet haben, während sie mit dem Vater das Kind von der Mutter abholte. Außerdem habe sie mit Nachbarn gesprochen.
Beim Familiengericht ist es nicht nötig, dass Zeugen im Gerichtssaal gehört werden, schriftliche Erklärungen reichen aus. Der Wahrheitsgehalt dieser Aussagen ist kaum zu überprüfen. Der Richter kann nicht nachbohren wie beim Strafprozess, den Zeugen an seine Wahrheitspflicht erinnern. Tanja Krügers Anwalt hat keine Schriftsätze dabei, die ihre Position stärken. Im Nachhinein betrachtet, sagt Tanja Krüger, sei sie viel zu unvorbereitet in die Verhandlung gegangen. Dabei hätte sie zahlreiche Stimmen beschaffen können, die bezeugt hätten, dass Tim bei ihr gut aufgehoben war.
Tims erwachsener Halbbruder erklärt gegenüber der ZEIT, dass seine Mutter zwar mitunter geschimpft, aber keineswegs ständig geschrien habe. Die Großeltern sagen, dass Tanja Krüger und ihr Enkelsohn ein inniges Verhältnis hatten. Ihr Exmann erzählt, dass Tanja Krüger eine ganz normale Mutter war. Auch die Kindergärtnerin hätte bezeugen können, dass ihr nichts Negatives an dem Kind aufgefallen sei. Tim sei selten krank und immer sehr gepflegt gewesen. Wenn seine Mutter ihn abholte, sei er freudig auf sie zugelaufen. Die Mutter von Tims bestem Freund, die ihren Sohn häufig zum Spielen vorbeibrachte, sagt gegenüber der ZEIT, dass die Kinder natürlich auch im Winter im Freien spielten, nicht weil sie mussten, sondern weil sie wollten. Ihr Sohn habe ihr erzählt, er und Tim hätten anschließend immer vor dem Kachelofen Kakao getrunken. Sie habe nie Bedenken gehabt, ihr Kind bei Tanja Krüger zu lassen – sie habe bis heute keine. Doch sie wird, wie alle anderen, bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht nicht gehört.
Dafür gibt eine Psychotherapeutin eine schriftliche Erklärung ab. Seit Tims Eltern sich das Sorgerecht teilen, hat Cornelia G. das ehemalige Paar von Zeit zu Zeit beraten. Ein Anwalt hatte sie den beiden empfohlen. Frau G. hat Tim nur ein Mal gesehen, wenige Tage vor dem Gerichtstermin, zusammen mit dem Vater und dessen Lebensgefährtin. In ihrer Stellungnahme schreibt sie, Tim brauche dringend therapeutische Hilfe, er wirke “emotional leer”. Dass Tim bei ihrem Besuch eine starke Bindehautentzündung hatte, erwähnt Frau G. nicht.
Tim selbst sitzt während seiner Anhörung vor Gericht auf dem Schoß der Lebensgefährtin des Vaters. Als der Richter ihn fragt, was er sich von den Eltern wünsche, sagt er bloß: “Mir fällt nichts ein.” So steht es in den Gerichtsakten.
Die Stellungnahme der Therapeutin, die Angaben der Hausangestellten des Vaters, das ablehnende Verhalten des Kindes auf dem Gerichtsflur. Das alles passt für den Richter nahtlos zu den anonymen Meldungen beim Jugendamt. So steht es in der Urteilsbegründung. Der Richter entscheidet: Der Mutter wird das Sorgerecht in Teilen entzogen. Das Aufenthaltsbestimmungsrecht erhält vorerst der Vater. Tim soll bei ihm leben.
Gerade 40 Minuten, erzählt Tanja Krüger, habe die Verhandlung gedauert. Dann sagt sie: “40 Minuten, um meinen Sohn zu verlieren. Können Sie sich das vorstellen?”
Einer, der es sich vorstellen kann, ist Jürgen Rudolph. Fast 30 Jahre lang war er Familienrichter, er gilt als einer der renommiertesten Fachleute in Deutschland. In unzähligen Streitfällen zwischen ehemaligen Lebenspartnern musste er Entscheidungen treffen. Er sagt, anfangs habe auch er oft den Fehler gemacht, Vater oder Mutter einfach aus dem Leben der Kinder hinauszukegeln. Zum einen, weil es beim Familiengericht um schnelle Erledigung gehe. Zum andern, weil er es nicht besser wusste. Wie viele Kollegen war auch Rudolph ohne Vorbereitung ans Familiengericht gekommen. Zuvor war er Richter in einer Baukammer gewesen und hatte sich dort unter anderem mit Trennungsfugen beschäftigt. Nun sollte er sich mit Familientrennungen auseinandersetzen. Vor allem die Kindesanhörungen überforderten ihn. Wie sollte er einschätzen, ob ein Kind manipuliert wurde? Ob es sagte, was es wirklich dachte? Was nützen einem all die Paragrafen, wenn man Kinderseelen nicht versteht und Verhaltensmuster nicht erkennt?
Irgendwann war Rudolph so frustriert, dass er gemeinsam mit anderen Richtern, Psychologen, Rechtsanwälten und Mitarbeitern des örtlichen Jugendamtes eine Arbeitsgruppe bildete. Sie luden Experten ein, die ihnen Grundlagen der Kinderpsychologie vermittelten. “Die erklärten uns, was das mit der Psyche eines Kindes macht, wenn es vom Richter direkt oder auch indirekt gefragt wird: Wen hast du lieber? Mama oder Papa?”
Rudolphs Gruppe entwickelte die Cochemer Praxis, benannt nach der Kleinstadt in Rheinland-Pfalz, in der Rudolph damals arbeitete. Nach diesem Ansatz sollen Jugendamt, Gericht, Anwälte, Sachverständige und Beratungsstellen zusammenarbeiten. Kooperation statt Koexistenz. Die Eltern sollen gerichtlich gezwungen werden, wieder ein Miteinander zu lernen, statt gegeneinander zu kämpfen, sie bekommen die Auflage, sich einer Beratung zu unterziehen. Die Cochemer Praxis wurde von Juristen viel gelobt. Umgesetzt wurde sie kaum. “Es gibt Gerichte, bei denen versucht wird, nach dieser Praxis zu arbeiten”, sagt Rudolph, “aber die kann man an einer Hand abzählen.”
Manche Familienrichter in Deutschland haben ihre eigenen fortschrittlichen Methoden entwickelt, sind psychologisch geschult. Doch an welchen Richter streitende Paare geraten, ist eine Frage des Glücks, oder des Pechs. Eine Pflicht, regelmäßig an Fortbildungsseminaren teilzunehmen, existiert für Familienrichter nicht. Psychologiekenntnisse sind nicht erforderlich. Auch gibt es für Richter zu wenige Möglichkeiten, sich psychologisch zu schulen. Die Deutsche Richterakademie bietet dieses Jahr genau einen Kurs zum Thema Umgangs- und Sorgerecht an. 40 Plätze für schätzungsweise 2.500 Familienrichter in Deutschland.
Der Richter im Fall Krüger war früher Strafrichter, seit 17 Jahren ist er beim Familiengericht. Das Amtsgericht schreibt auf Anfrage der ZEIT, Auskünfte zur individuellen Fortbildung von Richtern werden generell nicht erteilt. Warum, steht nicht dabei.
Man weiß nicht, ob der Richter anders entschieden hätte, wenn er eine Fortbildung hätte machen müssen. Aber nicht nur ein geschulter Richter, sondern jeder Mensch mit Feingefühl hätte erkennen müssen, dass man ein Kind nicht zu seiner Mutter befragen kann, während es auf dem Schoß der neuen Lebensgefährtin des Vaters sitzt. Wahrscheinlich hätte ein Menschenkenner auch das ablehnende Verhalten des Kindes gegenüber der Mutter anders gedeutet.
Ende Mai 2012, zwei Monate nach der Anhörung vor dem Amtsgericht, bekommt es Tanja Krüger vom Jugendamt schriftlich: Eine Kindeswohlgefährdung hat niemals bestanden.
Das könnte die Stelle in der Geschichte sein, an der sich doch noch alles zum Guten wendet: Das Jugendamt stellt fest, dass Tanja Krüger keine verantwortungslose Mutter ist, und das Gericht erkennt diesen Fall endlich als das, was er ist: ein Streit zwischen zwei Menschen, die sich einmal geliebt haben. Zwei Menschen, die lernen müssten, wieder miteinander zu reden, anstatt sich zu bekämpfen.
All das wäre möglich gewesen, der Richter aber bleibt bei seiner Entscheidung. Wochen vergehen, Monate, in denen die Mutter ihren Sohn nicht zu Gesicht bekommt. Zumindest das hätte eigentlich anders laufen sollen. Das Gericht hatte festgelegt, Tanja Krüger dürfe Tim im Rahmen eines sogenannten begleiteten Umgangs sehen.
Begleiteter Umgang heißt: Vater oder Mutter dürfen ihr Kind nur unter Aufsicht treffen. Ursprünglich war diese Regelung für Elternteile gedacht, denen nicht zu trauen ist, etwa weil sie psychisch krank sind, drogensüchtig oder gewalttätig. Inzwischen aber wird der begleitete Umgang in vielen Fällen fast standardmäßig angeordnet, wenn das Gericht den Eindruck hat, die Mutter oder der Vater habe sich etwas zuschulden kommen lassen.
Viele Eltern verstehen nicht, warum sie auf einmal dabei überwacht werden sollen, wie sie mit ihrem Kind spielen. Auch Tanja Krüger fällt das schwer. Trotzdem, sagt sie heute, sei sie bereit gewesen, sich darauf einzulassen. Doch der Termin für das erste Zusammentreffen von Mutter und Kind wird immer wieder verschoben. Der Vater behauptet, Tim wolle die Mama nicht sehen. Die Frau vom Jugendamt findet, man könne das Kind nicht zwingen. Auch Tanja Krüger will ihrem Sohn den begleiteten Umgang nicht um jeden Preis antun. Und schon gar nicht unter den neuen Umständen: Der Vater soll jetzt während des Umgangs auch noch dabei sein. “Ich habe gesagt, nur wenn das Treffen bei mir zu Hause stattfindet und ohne den Vater.”
Tanja Krüger hat sich inzwischen beraten lassen. Hat erfahren, dass es für ein Kind unerträglich ist, wenn es zwischen die Fronten gerät. Also zwischen Vater und Mutter. Ihr Vorschlag: Sie will mit Tims Vater zunächst zu einer Elternberatung gehen. Zuerst stimmt der Vater zu, dann doch nicht, sie können sich nicht einigen. So vergehen die Tage. Aus den Tagen werden Wochen, schließlich Monate. Lesen kann Tim zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Mutter kann ihm also nicht schreiben, wie sehr sie ihn liebt und vermisst.
Tanja Krüger fällt es schwer, darüber zu reden, wie es sich anfühlt, das eigene Kind nicht mehr zu sehen. Sie spricht lieber über Fakten, über Entscheidungen des Gerichts. Sie benutzt juristische Fachbegriffe, als sei sie Anwältin von Beruf, findet aber keine Worte dafür, wie es in ihr aussieht. Nur zögernd, fast unwillig, erzählt sie von der ersten Zeit ohne Tim. Wie sie sich, wenn es besonders schlimm war, selbst Kinderbücher vorlas. Wie sie sich vorstellte, was ihr Sohn wohl gerade macht.
Gerne würde man den Vater zu seiner Version der Geschichte befragen. Ein hoher Zaun umgibt sein Anwesen, zu dem nur ein Privatweg führt. Auf Briefe reagiert er nicht, seine Anwältin teilt am Telefon mit, ihr Mandant äußere sich nicht. Sie sagt auch, Tanja Krüger habe kein Interesse am Kind, sondern lediglich daran, sich als Opfer zu stilisieren.
In Tims Schule hat der Vater eine Liste hinterlegt. Darauf stehen die Namen der Menschen, die Tim sehen darf. Tanja Krüger steht nicht darauf, auch die Großeltern und der Halbbruder nicht. Natürlich versuchen sie trotzdem, Tim vor der Schule abzupassen. Einmal fährt der Großvater zum Anwesen von Tims Vater. Daraufhin beantragt dieser, Monate nach der Gerichtsverhandlung, dass sich die Kindesmutter und die Großeltern dem Jungen nicht auf mehr als 500 Meter nähern dürfen. Die Anwältin des Vaters argumentiert, es bestehe “Entführungsgefahr”.
Der Richter am Amtsgericht lehnt den Antrag ab. Eine Entführungsgefahr, so steht es in der Begründung, sieht auch er nicht.
Auch Tims Treffen mit seinem Kindergartenfreund hat der Vater inzwischen unterbunden. Seine Anwältin hat ihm dazu geraten, den Kontakt einzuschränken. So steht es in den Akten. Die Mutter des Freundes könne das Kind beeinflussen, argumentiert die Anwältin.
Erst im August 2012, fünf Monate nach der Gerichtsverhandlung, sieht Tanja Krüger ihren Sohn bei einer sogenannten Interaktionsbegutachtung wieder. Der Richter am Amtsgericht hatte nach dem Eilverfahren ein Familiengutachten in Auftrag gegeben. Eine Psychologin sollte herausfinden, wie das Sorgerecht auf Dauer geregelt werden soll. “Ich dachte, das Gutachten werde alles klären”, sagt Tanja Krüger. “Alles werde gut, wenn ich Tim erst wiedersehen würde, und der ganze Spuk wäre in ein paar Wochen vorbei.”
Doch nichts wird gut, es geschieht eine Katastrophe. Während Tanja Krüger mit Büchern, Spielzeug und Gebäck im Raum eines Instituts auf Tim wartet, hört sie von draußen lautes Weinen. Tim, auf dem Arm des Vaters, weigert sich, seine Mutter zu sehen, will sich nicht vom Vater lösen. Als Tanja Krüger auf Tim zugeht, weint er nur immer heftiger. Das Treffen wird abgebrochen.
Tanja Krüger versteht die Welt nicht mehr. Sie fragt sich: Wie kann es sein, dass mein eigenes Kind mich hasst? Sie recherchiert im Internet, spricht mit Experten, kauft sich Fachliteratur. Sie liest, dass Kinder, denen ein Elternteil abgewöhnt wird, diesen nach und nach ablehnen. Sie dürfen Mama oder Papa nicht mehr lieb haben. Der siegreiche Elternteil hat es ihnen verboten.
Auch der ehemalige Familienrichter Jürgen Rudolph kennt solche Fälle: “Ich hatte viele Kinder vor mir sitzen, die ganz normal wirken und die vehement behaupten: Ich will den Papa oder die Mama nicht sehen, ich will, dass der oder die tot ist. Da läuft es einem kalt über den Rücken. Sie übernehmen die Position des Elternteils, der sie betreut, weil sie panische Angst haben, diesen auch noch zu verlieren. Das ist eine Überlebensstrategie aus Hilflosigkeit heraus.” Ein anderer Familienrichter, der seinen Namen nicht nennen möchte, berichtet der ZEIT von einer Studentin, die Jahre nach dem Sorgerechtskrieg ihrer Eltern bei ihm auftauchte und ihm vorwarf: “Warum haben Sie nicht erkannt, was ich wirklich wollte?” Sie hatte als Kind in den Verhandlungen ausgesagt, sie wolle den Vater nie mehr sehen.
Es gibt sogar einen Spezialbegriff für dieses Phänomen: Eltern-Kind-Entfremdung. Der ehemalige Leiter des Münchner Staatsinstituts für Frühpädagogik, Wassilios Fthenakis, hat sie wissenschaftlich untersucht. Er sagt:
“Wenn das Kind verbal den Willen äußert, den anderen Elternteil nicht zu besuchen, ist das kein gesicherter Befund, dass das Kind es auch so meint.” Und kein Grund, den Kontakt abzubrechen. Im Gegenteil: Sei ein Elternteil des Kindes beraubt, führe das dazu, dass der Streit nur noch erbitterter und hasserfüllter werde. Das Kind werde zum Instrument, zur Waffe im Krieg mit dem Partner.
Wurde auch Tim zur Waffe seines Vaters?
Die Psychologin, die das Familiengutachten erstellen soll, notiert aus ihren Beobachtungen mit Tim:
Tim fragt, ob man die Mama nicht einsperren könne, weil sie so böse sei. Sie habe Sachen geklaut.
Woher er das wisse?
“Papa hat gesagt, einfach so geklaut.” Er habe den Papa noch gefragt, warum sie so böse ist, und der Vater habe gesagt: “Weil sie so böse ist.”
So steht es im Familiengutachten, das der Richter in Auftrag gegeben hat. Ende Oktober 2013 liegt es endlich vor. Nicht weniger als 18 Monate hat die Psychologin dafür gebraucht. Nach Gesprächen mit Mutter und Vater, der Kindergärtnerin, Tims Ärzten und Tim selbst kann sie zwar nicht ausschließen, dass das Kind vom Vater instrumentalisiert wird. Trotzdem empfiehlt sie, Tim solle bei ihm bleiben. Nach so langer Zeit, begründet sie ihre Empfehlung, sei nicht mehr festzustellen, warum Tim dermaßen ablehnend auf die Mutter reagiert. Es sei daher besser, Tim bleibe in seinem nun gewohnten Umfeld.
Der Richter hält sich daran. Im März 2014 spricht er das Sorgerecht vollständig Tims Vater zu. Im Beschluss des Gerichts heißt es: “Es fand lediglich ein Zusammentreffen aus der Ferne statt, als die Antragsgegnerin an der Schule erschien und dort einen kurzen Blick auf Tim erhaschen konnte. Er ist mit seiner Mutter überhaupt nicht mehr vertraut.”
Tanja Krüger weiß zu diesem Zeitpunkt schon, warum ihr Kind so reagierte. Sie hat begriffen, dass ihr Sohn nie aufgehört hat, sie zu lieben. Aber dieses Wissen ändert nichts daran, dass der Vater das Sorgerecht bekommt und dass es anderthalb Jahre dauert, bis ein Gutachten fertig ist. Es bringt sie nicht weiter. Also setzt Tanja Krüger sich wieder vor ihren Rechner und sucht nächtelang nach Antworten, nach einem Hebel, einem Fehler vielleicht, der das Gericht zwingen könnte, sein Urteil zu überdenken.
Und sie wird fündig. Sie stößt auf Cornelia G., jene Frau, deren Stellungnahme bei der Gerichtsverhandlung im März 2012, Tim wirke “emotional leer”, die Position von Tims Vater gestärkt hatte. Auf einigen Internetseiten taucht Frau G. als Psychotherapeutin auf, auf anderen aber als Heilpraktikerin. Kann es sein, dass die Frau, die damals erklärte, Tim brauche dringend therapeutische Hilfe, gar keine Psychotherapeutin ist? Sondern eine Hochstaplerin? Beim Amtsgericht hat sich Cornelia G. im Jahr 1998 als Psychotherapeutin eingetragen. In ihrer Kinder- und Elternberatungsstelle bietet sie Hilfe für Trennungsfamilien sowie begleiteten Umgang an. Allerdings hat Cornelia G. selbst im Jahr 2009 beim Amtsgericht darum gebeten, die Bezeichnung Psychotherapeutin zu streichen, weil sie keine sei. Dieses Schreiben ist beim Gericht einzusehen.
Tanja Krüger hat jetzt einen Beweis. Cornelia G., die Frau, die der Familienrichter als Psychotherapeutin ernst nahm, war bloß eine Heilpraktikerin. Während eine Psychotherapeutin einen Uni-Abschluss plus Zusatzausbildung braucht, benötigt eine Heilpraktikerin nicht einmal Abitur. Bei ihren Recherchen stößt Tanja Krüger auch auf einen Beitrag auf Twitter: Wer schlechte Erfahrungen mit Cornelia G. gemacht habe, der solle sich melden. Tanja Krüger antwortet. Ein paar Minuten später telefoniert sie mit der Frau, die den Aufruf geschrieben hat.
Inge Walther* erzählt ihr, dass sie und ihre Tochter bei Cornelia G. begleiteten Umgang hatten. Dass Cornelia G. für Behörden seitenlange Stellungnahmen über sie und ihre Tochter schrieb. Aussagen von Frau G. seien sogar in das Gutachten eingegangen, auf das sich das Gericht beruft. Frau G. sei ihr von Anfang an suspekt gewesen, sagt Frau Walther. Sie sei das Gefühl nicht losgeworden, die Psychotherapeutin arbeite gezielt gegen sie. Auch Inge Walther hat ihre Tochter seit Jahren nicht gesehen, auch sie ist in diesen Justizapparat geraten, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint. Und Frau Walther erzählt noch etwas: Sie kenne weitere Betroffene. Väter und Mütter, die das Sorgerecht verloren und ihre Kinder seit Monaten selten oder gar nicht gesehen haben. Dann sagt sie: “Wie wäre es, wenn wir uns alle einmal treffen?”
Ein paar Tage später sitzen sie in Inge Walthers Haus auf dem Land beisammen. Drei Mütter und ein Vater, die dasselbe Schicksal teilen. Zunächst reden sie über die Heilpraktikerin G., die in all ihre Fälle verwickelt ist. Auch den anderen hat Cornelia G. sich als Psychotherapeutin präsentiert. Schnell ist man sich einig: Tanja Krüger soll Frau G. wegen falscher Titelführung anzeigen, die anderen wollen als Zeugen aussagen. Dann erzählen sie ihre Geschichten, die sich auffallend ähneln: Bei allen argumentiert die Gegenseite, man habe Angst um die Kinder. Oder die Kinder müssten “etwas Zeit bekommen”. Inge Walther erzählt, sie sei verdächtigt worden, ihr Kind verwahrlosen zu lassen, und dass es erstaunlicherweise auch bei ihr die Haushälterin und Angestellte des Kindsvaters waren, die zu ihren Ungunsten ausgesagt hätten.
“Ach”, sagt Tanja Krüger erschüttert, “das ist ja wie bei mir.”
Je länger sie über ihre Fälle reden, umso mehr Gemeinsamkeiten tauchen auf. Besonders die Fälle Krüger und Walther gleichen sich an vielen Stellen. Sie gehen die Akten durch, die schriftlichen Erklärungen der Haushälterinnen.
“Ich habe Angst, dass Frau Walther ihrer Tochter etwas antut”, steht da. “Wir haben Angst um Tim, wenn er alleine mit ihr ist”, schreibt die Haushälterin auf Bitte des Vaters über Tanja Krüger.
“Auf Hygiene von Tim wird nicht geachtet (z. B. er ist oft nicht gewaschen)”, schreibt die eine Haushälterin. “Zur Hygiene kann ich sagen, dass ich die Tochter zwischendurch immer wieder gewaschen habe”, schreibt die andere Haushälterin.
Oder: Frau Krüger nehme sich keine Zeit, um das Mittagessen für Tim zuzubereiten. Beziehungsweise: “Ich habe für das Mädchen morgens Frühstück gemacht, weil Frau Walther das nicht gemacht hat.”
Die Angestellten beschreiben ähnliche Situationen und oft identische Ängste: Die Mütter ließen immer die Fenster offen stehen, das Kind werde schlecht ernährt. Eine innige Beziehung bestehe vor allem zum Vater – zur Mutter nicht.
Es wächst ein unheilvoller Verdacht: Kann es sein, dass es eine Art Betriebsanleitung gibt, wie man vorgehen muss, um den gegnerischen Elternteil aus dem Leben des Kindes zu reißen? Kann es sein, dass verschiedene Hausangestellte von verschiedenen Familien, die sich nicht kennen und nichts miteinander gemein haben, nahezu inhaltsgleiche Aussagen treffen? Oder haben sie gelogen? Aus Gefälligkeit? Für Geld?
Gibt es also ein Muster, auf das alle hereingefallen sind? Sogar das Gericht? Hatten Tanja Krüger und die anderen, ohne es zu ahnen, von Anfang an keine Chance?
Während sie über ihre Fälle diskutieren, fällt den verstoßenen Eltern etwas Merkwürdiges auf: Die Anwältin, die im Fall Krüger Tims Vater vertritt, arbeitet auch bei einigen anderen aus der Gruppe für die Gegenseite. Eine Mutter packt ihren Laptop aus, sucht im Netz nach Hinweisen. Tanja Krüger und die anderen schmieden einen Plan.
Ein paar Wochen später besucht eine der Teilnehmerinnen jenes konspirativen Treffens eine Gruppenberatung für Sorge- und Umgangsrecht: Es doziert jene Anwältin, die Tims Vater vertritt. In der Handtasche führt die Besucherin ihr Portemonnaie, ihr Handy und ein Aufnahmegerät mit sich. Damit zeichnet sie diese spezielle “Fortbildung” auf.
Der ZEIT liegt ein Mitschnitt des Seminars vor.
“Wenn Sie sagen, ich sehe den, und dann wird mir schlecht, ich kann mit dem nicht kommunizieren, dann ist das ein Totschlagargument, das ich auch schon benutzt habe”, rät die Anwältin.
Später sagt sie: “Es ist einfach wichtig, dass man das rechtzeitig aufstellt, dass man sich einen Plan macht, dass man sich nicht ins Bockshorn jagen lässt.” Und weiter: “Sie müssen mit Ihrer Angst arbeiten!”
Die Anwältin gibt ihren Zuhörern mit auf den Weg: Bringen Sie das Kind zu Frau Cornelia G. in die Beratung. Die könne dann dokumentieren, wie sehr das Kind leide. Die Telefonnummer von Cornelia G. weiß sie auswendig.
Dann sagt die Anwältin noch: “So kann man solche Dinge vorbereiten.”
Konfrontiert mit ihren eigenen Worten, will die Anwältin das zwar alles gesagt, aber anders gemeint haben. Am Telefon teilt sie mit, sie fühle sich “falsch verstanden”. Die Zitate seien aus dem Zusammenhang gerissen. Wie genau sie es gemeint hat, sagt sie aber nicht. Sie scheint sich keiner Schuld bewusst. Strafrechtlich gesehen, hat sie sich auch nicht schuldig gemacht.
Sie ist bei Weitem nicht die einzige Familienanwältin, die so arbeitet. Zur Zufriedenheit ihrer Klienten. Welches Unheil die Anwälte damit stiften und wie viele Kinderseelen sie zerstören, steht auf einem anderen Blatt.
Denn die moralische Frage bleibt: Wie weit dürfen Anwälte gehen, um für ihre Klienten einen Vorteil herauszuschlagen? Schließlich sollten doch alle vor dem Familiengericht für das Kindeswohl eintreten – gilt das nicht auch für die Anwälte der Eltern? Doch was ist das, das Kindeswohl? Nirgendwo ist es festgeschrieben – jeder kann diesen Begriff auslegen, wie er will. Und manche Väter oder Mütter verwechseln das Kindeswohl mit dem eigenen. Die Verfassung sichert dem Kind das Recht auf beide Eltern zu. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus.
Wissenschaftler des Psychologischen Instituts an der Universität Tübingen haben mehr als 1.000 Eltern befragt, die weniger Kontakt zu ihrem Kind haben, als sie wünschen. Zusätzlich hat der Studienleiter Hans-Peter Dürr Akten der Befragten ausgewertet. Er bezeichnet Deutschland familienrechtlich als “Entwicklungsland”. Der Fehler liege im System. An den Familiengerichten herrsche oft Anarchie. Dürr schätzt, dass in 30 bis 50 Prozent der Fälle mit Falschvorwürfen gearbeitet wird. Betroffene berichten ihm reihenweise von Willkür und Inkompetenz der Jugendämter und Gerichte. Außerdem seien Trennung und Scheidung für viele Anwälte und Gutachter ein Big Business, an dem sie sich gesundstoßen. Gerade die Anwälte in diesem Schlachtfeld bezeichnet Dürr als “bezahlte Kriegstreiber”.
Auch der pensionierte Richter Rudolph gibt offen zu, dass die komplette Isolierung eines Elternteils durchaus Methode hat. “Ich wüsste theoretisch sehr genau, wie ein Elternteil so auszugrenzen ist, dass er sein Kind nie wiedersieht.”
Es ist also ein schier aussichtsloser Kampf für die ausgegrenzten Eltern. Gegen Anwälte, denen das Kindeswohl egal ist, nicht aber ihr Honorar. Gegen eine regelrechte Streitbewirtschaftungsindustrie. Gegen Richter, die jeden Tag neue Fälle abarbeiten, unter Zeitdruck und mit wenig Ahnung von Kindern. Gegen Psychologen, die Monate für ein Familiengutachten brauchen. Gegen die Zeit. Denn: Jeder Tag trägt das Kind weiter weg und in die Arme des Gegners.
Im Januar hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass es Unrecht ist, Sorgerechtsverfahren in die Länge zu ziehen und Elternteile auszugrenzen. 15.000 Euro Entschädigung bekam ein Vater zugesprochen, weil die Gerichte das Umgangsrecht nicht effektiv durchgesetzt hatten. In zehn Jahren hat der Vater seinen Sohn nur zehn Mal bei einem begleiteten Umgang gesehen. Inzwischen ist der Sohn elf Jahre alt.
Bei Tanja Krüger tobt der Krieg ums Kind nun schon drei Jahre. Ein Krieg mit Nebenschauplätzen: Im Dezember 2014 sollte der Prozess gegen Cornelia G. stattfinden, die selbst ernannte Psychotherapeutin, gegen die Tanja Krüger Anzeige wegen Titelmissbrauchs erstattet hat. Drei weitere Zeugen haben sich gemeldet, um gegen sie auszusagen. Ein Mann wirft ihr sogar Erpressung vor: Erst nach zehn Stunden Psychotherapie in ihrer Praxis dürfe er sein Kind wiedersehen, soll sie ihm gedroht haben.
Cornelia G. erschien nicht zum Gerichtstermin. Sie war nicht verhandlungsfähig. Im März 2015 ist Cornelia G. wohl wieder gesundet, es findet eine Verhandlung vor dem Amtsgericht statt. Sie wird still und heimlich verurteilt. Ein Strafgeld in Höhe von 2.400 Euro soll sie wegen Titelmissbrauchs zahlen. Cornelia G. legt Berufung ein. Die Staatsanwaltschaft auch. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Das Landgericht wird nun entscheiden müssen, wann es eine Berufungsverhandlung gibt.
Doch selbst wenn Cornelia G. verurteilt würde, an Tanja Krügers Situation würde das womöglich nichts ändern. Denn auch wenn die schriftliche Einschätzung der falschen Therapeutin, Tim brauche dringend therapeutische Hilfe, im Nachhinein neu bewertet würde – Tims ablehnende Haltung bleibt. Genau wie die Frage: Hat Tanja Krüger nicht doch etwas falsch gemacht? Ohne Grund nimmt doch niemand einer Mutter das Kind weg! Oder doch?
Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass Tanja Krüger eine bessere oder schlechtere Mutter ist als andere. Nichts, was rechtfertigen könnte, dass ihr Sohn drei Jahre lang nicht bei ihr sein konnte. Ganz unschuldig an der Situation ist sie trotzdem nicht. Denn dass Tanja Krüger “mindestens gelegentlich zu einem rauen Umgangston greift”, wie es in den Gerichtsunterlagen steht, ist durchaus möglich. Dass der Streit mit ihrem Lebensgefährten immer mehr eskalierte – daran hat auch sie Anteil. Eine Mutter, der das Kind geraubt wird, ist zu vielem fähig. Tims Vater wirft Tanja Krüger vor, rufschädigende E-Mails in Umlauf gebracht zu haben. Diese E-Mails gibt es. Tanja Krüger streitet ab, sie geschrieben und verbreitet zu haben.
Tanja Krüger wiederum hegt den Verdacht, dass Tims Vater seine Hausangestellten zu einer Falschaussage angestiftet hat.
Und so geht er weiter, der Streit zwischen Mama und Papa. Ausgetragen auf dem Rücken des kleinen Tim. Bis zum Oberlandesgericht hinauf haben sie sich gestritten. Bis zu jenem Tag im Januar 2015. Wieder soll das Umgangsrecht verhandelt werden, die Frage, ob, wann und wie Mutter und Kind einander sehen sollen. Vier Stunden dauert die Verhandlung. Wieder werden die Eltern befragt. Wieder muss Tim vor einem Richter aussagen, was er über seine Mutter denkt. Ob er sie sehen möchte. Nein, sagt der inzwischen Achtjährige, “wenn ich die Mama besuchen würde, wäre das dem Papa nicht recht und mir auch nicht”.
Er glaubt, dass seine Mutter ihn nicht lieb hat. Vier Mal sagt er das. Am Ende entscheidet der Richter: Die Mutter soll ihren Sohn wieder regelmäßig sehen. Alle vier Wochen soll der Vater seinen Sohn zum begleiteten Umgang mit Tanja Krüger bringen – widersetzt er sich, muss er jetzt bis zu 25.000 Euro Ordnungsgeld zahlen.
Als sich die Türen des Gerichtssaals öffnen, kommt Tanja Krüger kopfschüttelnd heraus. Nein, es sei nicht schlecht gelaufen: “Aber wir stehen jetzt da, wo wir vor drei Jahren schon waren.” Drei Jahre verlorene Zeit. In denen aus dem Kindergartenkind, das gerne Tomte und der Fuchs vorgelesen bekam, ein Schulkind wurde. Geblieben sind die Erinnerungen. Und ein Einfamilienhaus, in das Tanja Krüger nur noch selten kommt. Sie hat eine Arbeit in einer anderen Stadt gefunden. Dort wohnt sie unter der Woche, das Haus behält sie nur, weil es, so sagt sie, Tims Zuhause ist.
Sein Kinderzimmer, in dem die Zeit stillsteht. Seine Sachen, die sie ab und zu wäscht. Seine Wanderschuhe, die vor der Tür stehen wie die eines Gestorbenen. Die Anziehsachen sind längst viel zu klein, die Schuhe auch. Ob ihr Sohn sich heute Poster an die Wände hängen würde? Sie weiß es nicht. Wenn sie ehrlich ist, kennt sie diesen Jungen gar nicht mehr. Vor Gericht sagte er aus, er finde die Weihnachtsgeschenke seiner Mutter doof. Ein Plastikdinosaurier und eine Fahrradklingel mit einem Dino darauf. Mit so etwas, findet Tim, spielen doch nur Babys.
Vier Wochen später, eine Stunde vor dem ersten Treffen, ruft der Sozialpädagoge an: Er sei nicht mehr für das Jugendamt tätig, das Treffen müsse ausfallen. Jetzt sucht das Jugendamt nach einem neuen Betreuer. Tims Vater schlägt vor, das Honorar aus eigener Tasche zu finanzieren, Tanja Krüger lehnt das ab. Auch wenn es eine Möglichkeit wäre, ihr Kind endlich wiederzusehen. Tanja Krüger ist misstrauisch geworden, glaubt nicht mehr an gut gemeinte Angebote. Sie will den offiziellen Weg. Bis heute, an Ostern, hat Tanja Krüger ihren Sohn nicht gesehen. Wenn ein Kind seine Mutter drei Jahre nicht sieht, haben alle versagt. Verloren hat aber vor allem einer. Tim.
(Von Nadine Ahr und Christiane Hawranek)
* Der Name und einige Lebensumstände wurden geändert
Dieses Dossier beruht auf gemeinsamen Recherchen der ZEIT und des Bayerischen Rundfunks (BR). Die Beiträge des BR sind online unter www.br.de/nachrichten abzurufen
Mitarbeit: Pia Dangelmayer