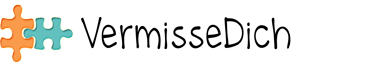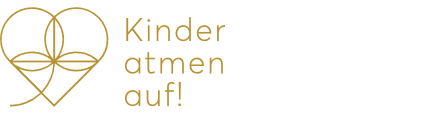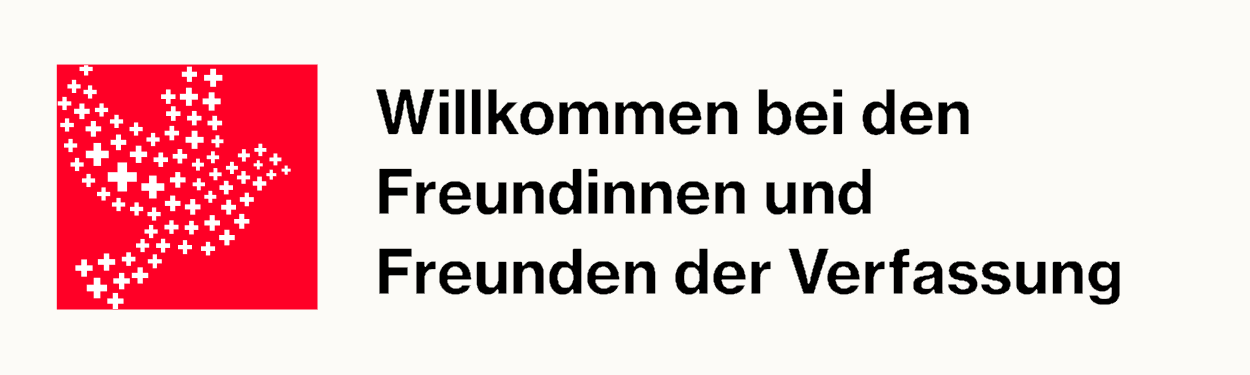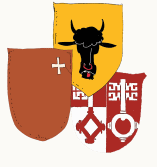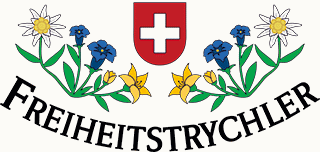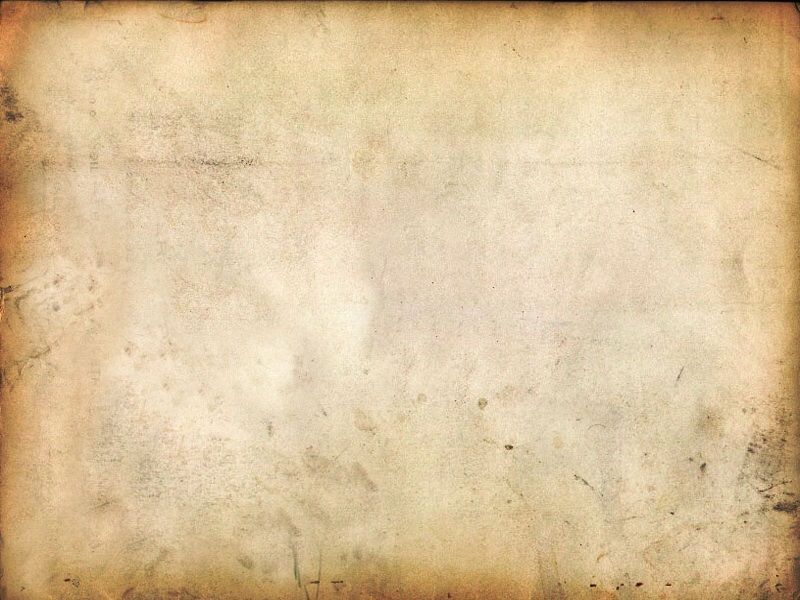Das Bundesverfassungsgericht klopft psychologischen Gutachtern auf die Finger. Damit stärkt es Eltern den Rücken, denen das Jugendamt ohne Not ein Kind wegnehmen will. Ein Fall statuiert ein Exempel.
Was für ein Satz, der jetzt vom Ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe zu lesen ist, ein Satz der Bodenständigkeit, Gelassenheit und Vernunft: „Die Eltern und deren sozio-ökonomische Verhältnisse gehören grundsätzlich zum Schicksal und Lebensrisiko eines Kindes.“ Da möchte man eigentlich nur wissen: Wer wollte diese höchstrichterliche Anthropologie bestreiten? Wer wollte bestreiten, dass man sich seine Herkunft nicht aussuchen kann, im Guten wie im Schlechten? Dass man allenfalls versuchen kann, für sich persönlich das Beste aus ihr zu machen?
Also: Wer bestreitet das? Bestritten wird dieser Realitätssinn von einem gerichtlichen Gutachterwesen, das nach dem Motto „Alles oder nichts“ für Eltern und ihre Kinder immer nur das Beste will – mit der beunruhigenden Konsequenz, dass, wer den Höchsterwartungen an sein eigenes Dasein und an das seiner Kinder nicht genügt, als nicht daseinstauglich, als anormal begutachtet werden kann und sich im Handumdrehen als jemand vorfindet, der weder rechts- noch erziehungsfähig ist. Wie viele Menschen sitzen fälschlicherweise in psychiatrischen Anstalten, nur weil ein Psychologen-Gutachten die Einweisung nahelegte? Immer mehr Fälle dieser Art werden bekannt. Und wie vielen Eltern werden aus demselben Grund ohne Not ihre Kinder weggenommen, vom Jugendamt in eine Fremdunterbringung gebracht?
Zäsur für das gerichtliche Gutachterwesen
Mehr als ein halbes Dutzend Mal haben die Karlsruher Richter in diesem Jahr Jugendämter und Gerichte gerügt, weil sie Eltern ohne tragfähige Begründung das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen haben. Dabei geht es selbstverständlich nicht um jene vergleichsweise wenigen, aber stark beachteten Fälle von schlimmer Verwahrlosung, bei denen das Jugendamt zu Recht und mitunter bedauerlicherweise auch zu spät einschreitet. Nein, stattdessen geht es um die vielen Fälle alltäglicher Denormalisierung, in denen der Staat unbotmäßig in private Lebensverhältnisse eingreift.
Jetzt hat, so sieht es aus, das Bundesverfassungsgericht in einem besonders fahrlässig gehandhabten Fall ein Exempel statuiert. Der Beschluss ist ein Dokument des Augenmaßes (Az. 1 BvR 1178/14) und dürfte eine Zäsur für das gerichtliche Gutachterwesen sein. Im Detail werden hier die Ansichten einer Sachverständigen dekonstruiert, welche maßgeblich dafür verantwortlich war, dass einem um Asyl ersuchenden Afrikaner zu Unrecht das Sorgerecht für seine Tochter aberkannt wurde. Zumal die beiden Fachgerichte werden gerügt, die ohne Wenn und Aber das fragliche Gutachten zur Grundlage ihrer nun aufgehobenen Entscheidung gemacht haben.
Mit geradezu spöttischem Unterton
Das Gutachten sei, so Karlsruhe, erkennbar nicht geeignet, die behauptete Kindeswohlgefahr aufzuklären: „Das hätten die Gerichte bei der Verwertung der Feststellungen des Sachverständigengutachtens berücksichtigen und die Feststellungen eigenständig auf ihre rechtliche Relevanz hin auswerten müssen. Dies ist nicht in der gebotenen Weise geschehen.“ Die Fachgerichte werden also ausdrücklich in die Pflicht genommen, sich nicht etwa blind auf ihre Gutachter zu verlassen, sondern deren Ergebnisse auf ihre Triftigkeit hin einer eigenständigen Prüfung zu unterziehen. Wie das geht, wird in dem Karlsruher Beschluss vorgemacht – mit vernichtenden Schlussfolgerungen für die Gutachter-Expertise.
Man meint einen geradezu spöttischen Unterton herauszuhören, wenn die Karlsruher Richter das von ihnen gerügte Amtsgericht Paderborn, dem sich das Oberlandesgericht Hamm anschloss, wie folgt wiedergeben: Der afrikanische, um sein Sorgerecht kämpfende Beschwerdeführer „sei derzeit nur eingeschränkt erziehungsfähig. Dies habe die Sachverständige, welche dem Gericht auch aus anderen Verfahren als kompetente und erfahrene Gutachterin bekannt sei, in ihrem schlüssigen, nachvollziehbaren und uneingeschränkt verwertbaren Gutachten festgestellt, dem das Gericht sich vollumfänglich anschließe.“
Das beschworene Optimum der Erziehung
Im nächsten Schritt wird ebendieses Gutachten vom Bundesverfassungsgericht ungerührt als unschlüssig, schlechterdings nicht nachvollziehbar und unverwertbar qualifiziert. Argument für Argument wird geprüft und für zu leicht befunden. Das ist eine Backpfeife, die sitzt. Vor allem aber fragt sich der sprichwörtlich unbescholtene Bürger: Was mag von Staats wegen alles möglich sein, wenn dies an Gerichten in Paderborn und Hamm möglich war? Wie schnell kann jemand auf dem Wege einer ad hoc wirksamen jugendamtlichen Vormundschaft von seinen Kindern getrennt werden, ohne dass man erst einmal viel dagegen machen kann? Es dauert ja Monate, bis eine Korrektur aus Karlsruhe greift.
In der Tat sind solche Befürchtungen nicht von der Hand zu weisen. In der jetzt verworfenen Gutachter-Logik kommt jedermann schnell in Teufels Küche. Was wurde im vorliegenden Fall nicht alles aufgeboten, welcher Aufwand an Aberwitz getrieben, um einem Vater sein Kleinkind wegzunehmen! Ein Kind wohlgemerkt, dem von seinem Vater offensichtlich nie auch nur ein einziges Haar gekrümmt worden ist, es hat mutmaßlich zu keinem Zeitpunkt einen Akt der Gewalt gegeben. Im Gegenteil springt die väterliche Zuwendung ins Auge, da sind sich alle Seiten einig. Was im Raum steht, ist allein die Möglichkeit, das beschworene Optimum der Erziehung – was immer dies für den Einzelfall heißen mag – zu verfehlen.
Bigotte Maßstäbe
Da wird von der Sachverständigen geltend gemacht, „dass der Kindesvater durch sein Verhalten das ängstliche Verhalten des Kindes eher durch starkes Schaukeln und lauteres Ansprechen verstärkt, statt es aufzulösen“. Es fehle ihm an der Fähigkeit, „die feinen Signale der Tochter“ zu erkennen, entsprechend sei die Entwicklung von Selbstwirksamkeitsvorstellungen und Selbstwertgefühl gefährdet. Hier hört man jeden Floh husten und überhöht mit Psychojargon, um dem Kindsvater eine autoritäre und gewaltbereite „afrikanische Erziehungsmethode“ zu unterstellen, weswegen „Nachschulungen“ im Hinblick auf „die Einsichtsfähigkeit in die europäischen Erziehungsmethoden“ für erforderlich gehalten werden. Für die Vermittlung der „Rechts- und Werteordnung unseres Staates“ sei der Vater seiner Tochter jedenfalls ebenso wenig ein „Vorbild im rechtsstaatlichen Sinne“ wie für ein „adäquates Verhältnis zu Dauerpartnerschaft und Liebe“. Und so in einem fort.
Karlsruhe steigt angesichts solch bigotter Maßstäbe ins Mikromilieu der Vater-Kind-Beziehung ein, um die Beobachtungen des Gutachtens als haltlos und nicht einschlägig abzuweisen. So heißt es etwa zum Vorwurf der Empathielosigkeit, wie sie die Sachverständige während der begrenzten Zeiten des begleiteten Umgangs des Vaters mit seiner Tochter bemerkt haben will: „Aus den Umgangskontakten werden nur Schwierigkeiten beschrieben, die sich ohne weiteres mit der durch die Fremdunterbringung verursachten Unerfahrenheit des Beschwerdeführers erklären lassen. Das gilt für die von der Sachverständigen beobachtete – und als Ausdruck mangelnder Wahrnehmung der kindlichen Bedürfnisse bewertete – Situation, dass der Beschwerdeführer das Baby gewickelt habe, obwohl die Pflegemutter erkannt hatte, dass das nicht nötig war.“ Am Ende wird die Sachverständige der Inkompetenz und Voreingenommenheit überführt.
Elternschaft ohne staatliches Zertifikat
Entscheidend ist in den Karlsruher Ausführungen aber immer wieder die Formel „dessen ungeachtet kann ohnehin nicht“, mit der die Richter die Proportionen zurechtrücken. Das bedeutet: Selbst wenn dem Vater mangelnde Empathie vorgehalten werden könne, selbst wenn sein Vorbildcharakter in puncto Werte- und Rechtsordnung nicht fehlerfrei erwiesen ist – selbst dann bliebe er der Vater seiner Tochter, die nicht von ihm getrennt werden dürfe. „Dessen ungeachtet“, so wird denn auch festgestellt (also ungeachtet dessen, dass dem Vater im konkreten Fall gar nichts Negatives nachweisbar ist), würde „ein geringes Maß an elterlicher Feinfühligkeit ohnehin nicht ohne Weiteres zu einer nachhaltigen, die Trennung rechtfertigenden Gefährdung des Kindeswohls führen“.
Denn umgekehrt wird ein Schuh daraus: Eltern müssen ihre Erziehungsfähigkeit „nicht positiv unter Beweis stellen“; vielmehr setzt eine behördliche Wegnahme ihrer Kinder „umgekehrt voraus, dass ein das Kind gravierend schädigendes Erziehungsversagen mit hinreichender Gewissheit feststeht“. Das also, die Klärung der Beweislastverteilung, ist der springende Punkt, wenn in dieser wegweisenden Entscheidung voller gesellschaftspolitischer Implikationen das Elternrecht gestärkt wird. Eltern haben qua Elternschaft eine verfassungsrechtlich geschützte, primäre Erziehungszuständigkeit und brauchen dafür kein staatliches Zertifikat. Soll davon dispensiert werden, so gelten allerstrengste Begründungs- und Darlegungspflichten. Die Eltern, so bekräftigt es Karlsruhe, „können grundsätzlich frei von staatlichen Eingriffen nach eigenen Vorstellungen darüber entscheiden, wie sie die Pflege und Erziehung ihrer Kinder gestalten und damit ihrer Elternverantwortung gerecht werden wollen“. Es gehört nicht zur Ausübung des staatlichen Wächteramtes, „gegen den Willen der Eltern für eine bestmögliche Förderung der Fähigkeiten des Kindes zu sorgen“.
Mit anderen Worten: Eltern sind Schicksal und Lebensrisiko ihrer Kinder – und sollen es bleiben. Das ist in Zeiten des erzieherischen Enhancement-Wahns ein höchstrichterliches Plädoyer für Tiefenentspannung. Man kann dafür nur dankbar sein.
Quelle: F.A.Z. / Autor: Christian Geyer-Hindemith
Frankfurter Allgemeine Zeitung


 (11 Bewertungen, Durchschnittlich: 4,82 von 5)
(11 Bewertungen, Durchschnittlich: 4,82 von 5)