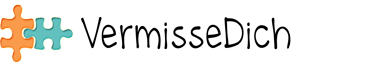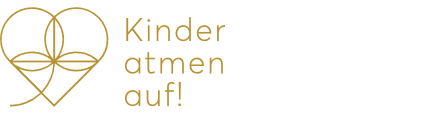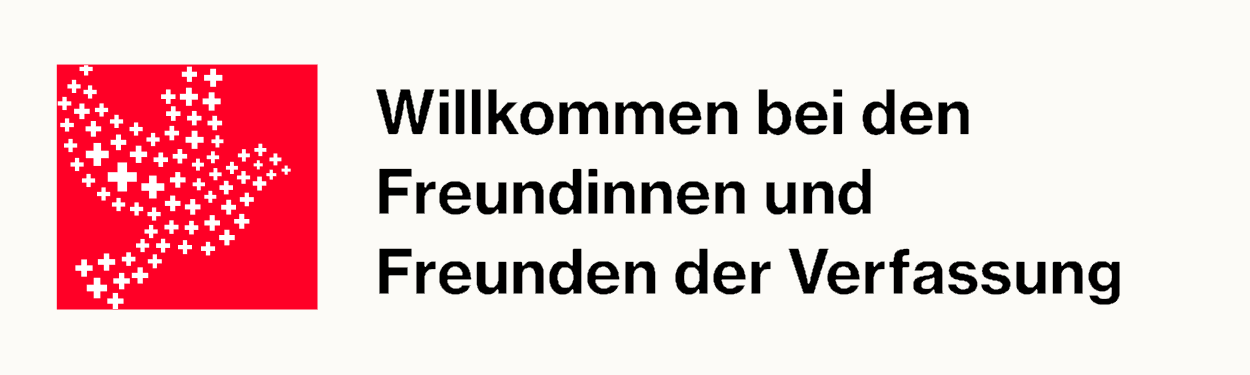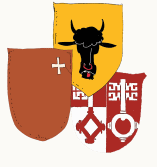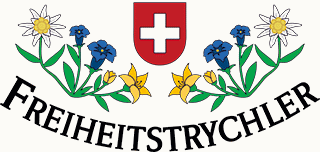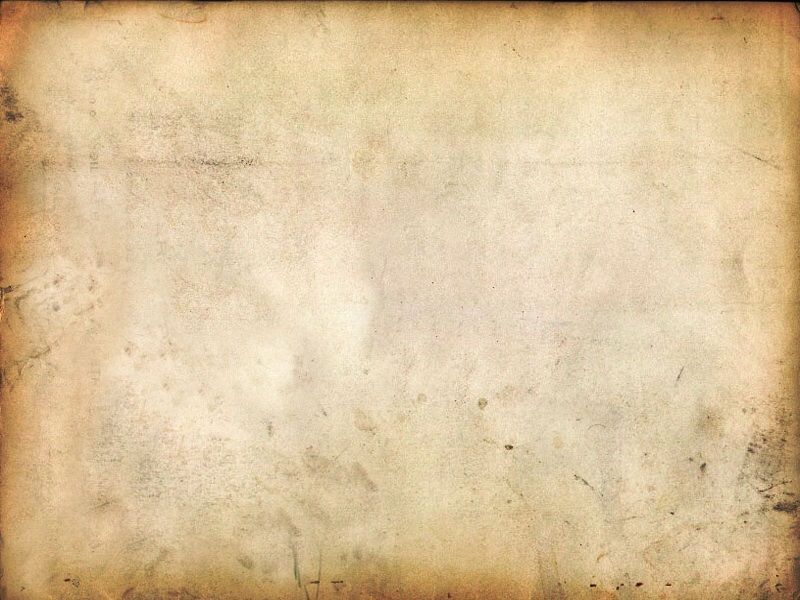ERITREA – Tausende fliehen jährlich aus Eritrea und bitten in Europa um Asyl – auch in der Schweiz. Zurecht? SVP-Grossrätin Sabina Geissbühler schaute sich die Lage vor Ort an. Lesen Sie hier ihre Eindrücke.
«Als Mitglied der Sicherheitskommission des Kantons Bern musste ich mich in den letzten Jahren immer wieder mit Kreditaufstockungen für die Betreuung vor allem von jungen Eritreern beschäftigen.
Das veranlasste mich, selbständig eine Reise nach Eritrea zu organisieren. Ich kaufte eine Landkarte, zeichnete meine geplante Rundreise ein, rechnete die Tagesstreckenkilometer aus, die ich zum Teil mit dem Fahrrad zurücklegen wollte. Seit Jahren erkunde ich fremde Länder mit dem Fahrrad. So kann ich anhalten, wo ich will und den Kontakt mit der Bevölkerung am besten herstellen.
Leider kam dieses Vorhaben aus verschiedenen Gründen nicht zustande. Im Hochland begann gerade die Regenzeit, und auf der Strecke von der Hauptstadt Asmara (2300 m über Meer) nach Massawa verkehren Lastwagen, welche die Bodenschätze zum Hafen am Roten Meer transportieren. Deshalb wäre diese Strecke gefährlich gewesen.
Auch war mein Programm sehr gedrängt, sodass ich schlussendlich froh war, mit einem Auto reisen zu können. Meine anfängliche Enttäuschung verflog auch bald, denn ich durfte bei den Ministern und Sportfunktionären auf der grossen Tribüne am Volksfest Giro Asmara, einem wichtigen Velorennen, dabei sein.
Hunderte von Zuschauern beklatschten die Radsportler, Frauen brauten Kaffee und boten uns in grossen Körben Popcorn und Getreidekörnermischungen an. In Eritrea hat Sport einen sehr hohen Stellenwert; denken wir an die Persönlichkeiten wie Bereket Yemane, Daniel Teklehaimanot oder Samson Gebreyohannes.
Vor meiner Abreise nahm ich Kontakt mit Eritreern auf, welche sich schon lange in unserem Land befinden. Wie nach dem Schneefallprinzip erhielt ich Adressen von Einheimischen, Spital- und Schulleitenden. Auch Reisebegleiter empfahlen sich, denn ein solches Gesuch würde sie vom Nationaldienst dispensieren und ihnen einen zusätzlichen Verdienst ermöglichen.
Obschon auf der Landkarte in den Städten Hotels eingezeichnet sind, war es nur in der Hauptstadt Asmara möglich, eine erste Nacht via Internet zu buchen. Auch wurde ich von der Mitteilung enttäuscht, dass einige meiner Wunschdestinationen aus Sicherheitsgründen nicht besucht werden könnten. Meine Familie machte sich sichtlich Sorgen über diese abenteuerliche Reise in den «Schurkenstaat», wo Hunderte unbescholtene Bürgerinnen und Bürger verschwänden.
Als ich in Dubai das Flugzeug nach Asmara bestieg, kam ich mir als einzige Weisse ohne Kopftuch oder Niqab wie eine Exotin vor. Die Reisenden waren vollbepackt mit Plastiktaschen und Koffern – wie sich später herausstellte, waren darin Waren, die in Eritrea in kleinen Läden oder auf der Strasse verkauft werden. Ich kam morgens um 6.30 Uhr in Asmara an, bezog ein Zimmer im zur italienischen Kolonialzeit erbauten Albergo Italia und suchte nach Möglichkeiten, «Opfer» für meine vorbereiteten Interviews zu finden.
Ich setzte mich zu meist jungen Einheimischen auf die Treppe zur orthodoxen Kirche, ins Asmara Café oder stellte mich zu Wartenden an eine Bushaltestelle. Meist trafen mich misstrauische Blicke. Doch schon mit dem Wort selam (salü) war meist das Eis gebrochen. Sagte ich als Nächstes, dass ich aus der Schweiz komme, strahlten die Augen der Gesprächspartner.
Ja, sie hätten Freunde, Verwandte im Heaven Schweiz oder im Paradise Schweiz und die hätten gute Jobs und würden viel Geld verdienen. Dann erwähnten sie aber auch, dass an der Grenze zu Sudan Kleinbusse bereitstünden und viele eritreische Familien Geld für Schlepper sammeln, und dann die jungen Eritreer ins Ausland verdingen würden.
Auch bereits in der Schweiz wohnhafte Verwandte leisteten finanzielle Hilfe, damit Schlepper bezahlt werden könnten. Die Familienangehörigen hofften, dass die «Verdingkinder» in der Schweiz möglichst schnell zu Geld kommen
oder ein Familiennachzug möglich würde.Ältere Menschen beklagen, dass sie unter dem heutigen Präsidenten Jsayas Afewerki einen 30-jährigen Befreiungskrieg gegen den grossen Nachbarn Äthiopien geführt und gewonnen hätten, und viele Junge abhauten. Tatsächlich müsste der Sicherheitsrat endlich von Äthiopien die Einhaltung des 1991 abgeschlossenen Friedensvertrags von Algier durchsetzen.
Der viel diskutierte Nationaldienst sieht folgendermassen aus: Nach zwölf Schuljahren kommen die jungen Menschen nach Geschlechter getrennt in eine halbjährige Militärausbildung nach Sawa.
Nach diesen sechs Monaten gehen alle ein halbes Jahr am selben Ort zur Schule und schliessen danach mit einer Prüfung ab. Die circa 20 Prozent Besten dürfen ein Studium beginnen, die circa 30 Prozent Schlechtesten werden dem Militärdienst zugewiesen und die Mehrheit dazwischen wird je nach Fähigkeit im Nationaldienst, das heisst in vom Staat geschaffenen Jobs wie Büro, Servicepersonal oder in Kleinunternehmen eingesetzt.
Dies führt dazu, dass es kaum Arbeitslosigkeit gibt, dass alle genug zu essen und Zugang zu frischem Wasser haben. Süchtige oder Verwahrloste habe ich keine gesehen. Was auffällt: Fast alle sind gepflegt und gut gekleidet.
In Internetcafés, aber auch im Fernsehen (z. B. BBC) können Infos aus aller Welt empfangen werden, auch Mobiltelefone sind sehr verbreitet. Bei Besuchen in Schulen, Spitälern oder Gesundheitszentren in ländlichen Gebieten konnte ich mich von einer hohen Qualität überzeugen.
Die Kindersterblichkeit ist im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern sehr niedrig, Masern und Polio sind ausgerottet. Gesetze verbieten Genitalverstümmelung von Mädchen und die Verheiratung von unter 18-Jährigen. Es besteht Religionsfreiheit: Christen und Muslime (je rund 50 Prozent) leben friedlich zusammen, und das soziale Gefälle ist gering.
Auf dem Land finden überall Märkte statt, der attraktivste ist in Keren. Dort werden vor allem auch Tiere gehandelt. Mein einheimischer Führer kaufte sich eine Ziege. Sie sollte mit den vier Beinen zusammengebunden im Kofferraum drei Stunden lang transportiert werden. Ich konnte durchsetzen, dass sie neben mir im Auto stehen durfte und für ihre letzte Reise Futter und Wasser bekam.
Am Abend wurde die ganze Sippe zum Festessen eingeladen. Die Zusammengehörigkeit in den Familien ist zentral.
Deshalb ist für mich die tragische Trennung der Kinder von ihren Eltern, ihrer Heimat und Kultur, sowie die Risiken auf der langen Reise unerträglich geworden.Die Schweiz muss das traurige Verdingkinderwesen stoppen und damit den Schleppern das Handwerk legen. Mit
finanziellerHilfe vor Ort, zum Beispiel mit der Einführung unserer dualen Berufsbildung, müssen wir unsere Verantwortung wahrnehmen.»(Von Sabina Geissbühler-Strupler)

Bildnachweis: https://www.svp.ch/de/cache/file/26C5CF76-F903-485D-AB99123B055C780A.jpg


 (6 Bewertungen, Durchschnittlich: 4,83 von 5)
(6 Bewertungen, Durchschnittlich: 4,83 von 5)